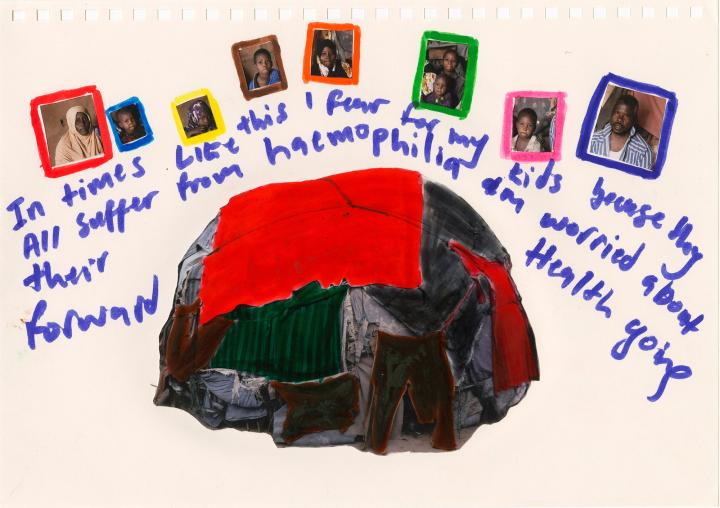Konfliktzonen: Allgegenwärtige Gewalt

Beirut, Libanon, 1977. Ein Mann mit einem amputierten Bein vor einem zerbombten Gebäude.
© A. Abbas / Magnum Photos«Wir behandelten die Menschen unter dem Beschuss von Elite-Scharfschützen.» Mit diesen Worten beschrieb ein freiwilliger Mitarbeitender von Ärzte ohne Grenzen kurz nach seiner Rückkehr aus dem Libanon am 14. Juni 1976 in der französischen Medizinzeitschrift Tonus seine Erfahrungen. Bereits seit dem Frühjahr 1975 tobte im Libanon ein Bürgerkrieg. Für Ärzte ohne Grenzen war es der erste Einsatz mitten in einem Kriegsgebiet. Die Gewalt dauerte fast ein Jahrzehnt lang an, und rund ein Dutzend Fotografen der Agentur Magnum hielten die Realität der Menschen, die im Libanon zwischen den sich stets verschiebenden Frontlinien festsassen, in Bildern fest. In einem solch extremen Kontext besteht – wie in vielen anderen Konflikten – die Mission der Fotografinnen und Fotografen darin, als Augenzeugen zu fungieren. Auch die humanitären Hilfskräfte verfolgen zusätzlich zur Behandlung der Menschen dieses Ziel. Seit 50 Jahren erzählen beide Gruppen auf ihre Art von der Komplexität der Einsätze, der Not, aber auch der Würde der Menschen, die diese absurde Gewalt überleben.
Eine durch Gewalt geprägte Realität
Ende 1975 wurde Ärzte ohne Grenzen auf Bitten des palästinensischen Roten Halbmonds in Beirut im belagerten Stadtteil Nabaa-Borj Hammond tätig. In dieser isolierten schiitischen Enklave in christlichem Gebiet lebten hunderttausende von der Welt abgeschnittene Menschen. Das kleine Team aus einem Chirurgen, einem Anästhesisten und zwei Pflegefachfrauen arbeitete Tag und Nacht, um sich um den nicht abreissenden Strom an Verletzten zu kümmern. Die humanitären Mitarbeitenden lebten dabei unter den gleichen Bedingungen wie die Menschen vor Ort. Ohne Strom, Radio oder andere Kommunikationsmöglichkeiten wechselten sich die Teams in der libanesischen Hauptstadt bis Juli 1976 ab, als das Spital aufgrund der sich zuspitzenden Kriegshandlungen schliessen musste.
Mit diesem Einsatz hatten sich die humanitären Hilfskräfte dazu entschieden, sich der gleichen Gewalt auszusetzen wie die Menschen vor Ort, um ihnen so gut wie möglich helfen zu können. Der zivilen Bevölkerung beizustehen bedeutet, jene zu unterstützen, die von der Öffentlichkeit am wenigsten wahrgenommen werden. Erst wenn dies gewährleistet ist, nehmen humanitäre Organisationen eine bedeutende Rolle wahr.

Beirut, Libanon, 1983. Kinder beim Spielen in Autowracks in der Nähe der Lager von Sabra und Chantila. 1983
© Chris Steele-Perkins / Magnum PhotosAuch für die Fotojournalistinnen und -journalisten bedeutet das Dokumentieren des Krieges mehr als nur Militärtaktiken oder Explosionen zu beobachten; sie begleiten die Zivilbevölkerung und nehmen ihre Perspektive ein. Genau dieses Ziel verfolgte auch Raymond Depardon, als er im Sommer 1978 einen Monat in Beirut verbrachte und versuchte, alle Facetten dieser Realität zu erfassen, vor allem die Konsequenzen des Konflikts.
Werde Teil unserer Geschichte, abonniere unseren Newsletter.


«Muslime, Christen, die Stadt, die Strände: Beirut war zu dieser Zeit von Kontrasten geprägt», schreibt Raymond Depardon. In einem Bürgerkrieg ist die Bewegungs- und Handlungsfreiheit jedoch eingeschränkt. «Ich lernte, zu verstehen, zu gehen, mich fortzubewegen, meine Passierscheine in meinen Schuhen zu verstecken und mich nicht zu vertun – zwei Passierscheine für die christliche Seite, zwei für die muslimische, die ich auf keinen Fall verwechseln durfte.»
Ähnlich schilderten es auch die Mitarbeitenden von Ärzte ohne Grenzen: «Unser Fahrzeug hatte absichtlich kein Logo: Während es bei einigen Begegnungen nützlich gewesen wäre, wären wir damit bei anderen ein grosses Risiko eingegangen», berichtete eine Pflegefachfrau im Mitarbeitermagazin der Organisation im Jahr 1986. Auf dem Fahrersitz nahmen abwechselnd Muslime und Christen Platz, damit wir ungehindert durch die verschiedenen Zonen von Beirut bis zu unserem Spital im Kampfgebiet kamen.»
In jedem Krieg geht es auch um politische Fragen und die verschiedenen Konfliktparteien versuchen mit allen Mitteln, sich Vorteile zu verschaffen. Humanitäre Mitarbeitende und Fotografinnen und Fotografen müssen ständig verhandeln, um ihren Wirkungsbereich abzusichern. So wurde beispielsweise 1978 dank des IKRK ein Waffenstillstand von drei Stunden vereinbart, um einem Fahrzeug von Ärzte ohne Grenzen mit Freiwilligen zu ermöglichen, in die zu der Zeit belagerte christliche Stadt Zahlé zu gelangen. Sie blieben bis zur Bombardierung der Stadt im Jahr 1981 dort. Das gleiche Szenario spielte sich 1983 in Dair al-Qamar ab. Im darauffolgenden Jahr zog sich die Organisation endgültig zurück, da die Sicherheit der Freiwilligen nicht mehr gegeben war.
Während es ausschlaggebend ist, so nah wie möglich an den Orten der Kämpfe zu sein, ist die Gefahr allgegenwärtig und zahlreiche Einschränkungen zwingen humanitäre Helferinnen und Helfer und Journalistinnen und Journalisten dazu, sich an ein ständig wechselndes Umfeld anzupassen.
Ins Kriegsgebiet gelangen und den Einsatz fortführen
«Man kann jederzeit an den Punkt gelangen, an dem man die Grenze zwischen Vorsichtsmassnahmen und Wagnis überschreitet. Der Krieg ist da, ganz nah. Seine Windungen sind komplett unvorhersehbar und seine Logik ein Geheimnis, das nur die wenigen Eingeweihten kennen. Für das Team, das innerhalb von ein paar Stunden an den Rand des Infernos oder sogar in sein Zentrum katapultiert wird, besteht die höchste Priorität darin, sich an die neue Situation anzupassen. Manchmal mitten in einem plötzlichen Schusswechsel.» Mit diesen Worten beschreibt der Arzt Alain Dubos seinen Einsatz mit Ärzte ohne Grenzen im Tschad 1980.


Ab 1979 kämpften bewaffnete Gruppen um die Kontrolle über N'Djamena. Die Bevölkerung floh in Richtung des benachbarten Kameruns, wo ein Team von Ärzte ohne Grenzen tätig war. Im April 1980 behandelten die medizinischen Teams auch in zwei Spitälern der Hauptstadt des Tschad Verletzte. Angesichts des gewaltreichen Konflikts handelte es sich vor allem um Notfälle, insbesondere chirurgische Eingriffe. Um ihre Neutralität zu wahren, halfen die humanitären Einsatzkräfte beiden Lagern im gesamten Land. Es machten jedoch Gerüchte die Runde, dass die Mitarbeitenden der Freiwilligenorganisation den Rebellen Waffen zuschanzten. Als eine der Parteien Unterstützung von Libyen erhielt, eskalierte die Gewalt und die Unsicherheit nahm weiter zu. Im Januar 1984 wurden zwei Freiwillige von Ärzte ohne Grenzen entführt und zwei Monate lang in Geiselhaft gehalten.
In Afghanistan waren die Fotografinnen und Fotografen und die humanitären Teams die einzigen Augenzeugen der im Land herrschenden Gewalt. Raymond Depardon dokumentierte ab 1978 die Situation und Lebensbedingungen in Nuristan, einer an Pakistan grenzenden Provinz, die gegen Kabul aufbegehrte. Infolge seiner in der französischen Zeitschrift Paris Match abgedruckten Reportage beschloss Claude Malhuret, der damalige Präsident von Ärzte ohne Grenzen, einen Erkundungseinsatz zu organisieren.




Juliette Fournot, Einsatzleiterin bei Ärzte ohne Grenzen von 1982 bis 1989, ist in Afghanistan aufgewachsen. «Ich kenne das Land sehr gut und spreche die Sprache. Ich werde eher wie eine Schwester wahrgenommen. Ich denke, dass ich die moralische Verpflichtung habe, alles zu tun, was in meiner Macht steht, um den Menschen medizinische Hilfe zukommen zu lassen, die so viel mehr ist als nur das. Die Menschen sind so allein in diesem Krieg, der nicht enden will.»

Provinz Logar, Afghanistan, 1984.
© Steve McCurry / Magnum PhotosIm Norden des Landes startete 1980 der heimliche Einsatz von Ärzte ohne Grenzen. 35 Tage Fussmarsch sind nötig, um die vier Tonnen medizinisches Material auf dem Rücken von Maultieren und Pferden über die afghanischen Berge zu transportieren. Die kleinen Spitäler der Organisation behandelten vor allem Frauen und Kinder, die Hauptleidtragenden des Konflikts. «Ich habe den Krieg und seine Folgen gesehen: Die von Minen verstümmelten Kinder, ihre entzündeten Beine und das aufgrund nicht erfolgter Behandlung abgestorbene Gewebe», erzählt Juliette Fournot. «Da habe ich entschlossen zu bleiben.» Die Familien strömten aus allen Tälern zur Klinik, und so wurden jeden Monat rund 3000 Menschen behandelt.
Die Medizinerinnen und Mediziner waren die einzigen, die wirklich wussten, was die afghanische Bevölkerung in diesen abgelegenen Provinzen durchmachte. Ärzte ohne Grenzen beschloss daher, das Wort zu ergreifen und die Öffentlichkeit über die Situation zu informieren. Am 25. September 1984 rief Claude Malhuret in der französischen Zeitung Le Monde dazu auf, Verantwortung zu übernehmen, um dieses Massaker zu beenden. «Indem wir anprangerten, was vor Ort geschah, konnten wir mehr Menschen retten als die paar, die wir vor Ort erreichten.»
Trotz der internationalen Mobilisierung wurden die Einrichtungen der Organisation regelmässig von der sowjetischen Armee bombardiert. Die Sicherheitslage verschlechterte sich im Laufe der Jahre immer weiter, bis der Einsatz schliesslich abgebrochen werden musste. Die Neutralität der humanitären Einsatzkräfte reichte nicht mehr aus, und die Rivalitäten zwischen den bewaffneten Mudschaheddin brachten Angriffe, Raubüberfälle und Geiselnahmen mit sich. Im April 1990 wurde Frédéric Galland, ein Arzt der Organisation, der im Spital von Yaftal arbeitete, ermordet. Daraufhin entschieden die humanitären Helferinnen und Helfer, sich aus dem Land zurückzuziehen.

Kabul, Afghanistan, 1995
© Steve McCurry / Magnum PhotosZu einem anderen Zeitpunkt – 2003 – und in einem anderen Kontext – Darfur – entlud sich die gleiche Art von Gewalt. Und auch hier gab es Hürden für die Erfüllung des humanitären Auftrags. Der Konflikt, in dem sich die Rebellengruppen und die von der Regierung in Khartum bewaffneten Dschandschawid-Milizen gegenüberstanden, führte zu über 300 000 Toten und Tausenden Vertriebenen. Elsafi Mahadi Bushara, die aus Darfur stammt und 2020 bei Ärzte ohne Grenzen im Sudan für die Logistik verantwortlich war, erinnert sich an das Leben in ihrer Region, bevor die Gewalt dort ausuferte. «Vor dem Konflikt lebten die verschiedenen Stammesgruppen in Frieden, niemand lief mit einer Waffe herum. Nirgendwo war es gefährlich. Man konnte ohne Geld in der Tasche reisen und wurde von den Menschen zu einem gemeinsamen Essen willkommen geheissen.» 2003 kam es dann durch die politische Spaltung zwischen Arabern und Nicht-Arabern zum Blutbad. Die Anweisung lautete: «Nehmt alles, was ihr wollt: Ländereien, Eigentum und bringt alle um, die noch da sind.»
Der Fotograf Paolo Pellegrin war nach Süd-Darfur gereist, um von der Not der durch die Gewalt vertriebenen Menschen zu berichten. Sie lebten unter äusserst prekären Bedingungen, und die Kinder traf es am schlimmsten.

Süd-Darfur, Sudan, 2004. Mädchen in einem Vertriebenenlager in Zelingei während eines Gewitters.
© Paolo Pellegrin / Magnum Photos

Die humanitären Hilfsorganisationen waren zwar vor Ort tätig, aber durften nur in den Vertriebenenlagern arbeiten und wurden später aus dem Land ausgewiesen, meistens mit der Begründung, sie würden die Feinde unterstützen. «Da die NGOs in Rebellengebieten arbeiteten, wurde ich festgenommen und beschuldigt, für Ärzte ohne Grenzen als Handlangerin tätig zu sein», so Elsafi Mahadi Bushara weiter. «Die Behörden fanden keine Beweise, und ich wurde wieder freigelassen. Anschliessend wurde Ärzte ohne Grenzen des Landes verwiesen. Innerhalb von zwei Stunden verbrannten wir alle Archive, damit die Behörden dem Personal vor Ort und den Patienten nichts anhaben konnten. Ich mietete dafür eine Bäckerei mit einem grossen Ofen an.»
Die Strategie der «stillen Diplomatie», die darin bestand, die internationale Gemeinschaft, einschliesslich der Vereinten Nationen, in bilateralen Gesprächen auf die Gewalt und die Hindernisse für Hilfsleistungen aufmerksam zu machen, war nicht erfolgreich. Auch heute sind die Narben in Darfur noch sichtbar. Die Gewaltausbrüche gehen weiter.Millionen Vertriebene leben noch immer in Lagern und können nicht nach Hause zurückkehren.
Humanitäre Hilfskräfte und Fotografinnen und Fotografen haben vielleicht nicht die Möglichkeit, einen Krieg zu beenden, aber sie arbeiten unermüdlich daran, dass Hilflosigkeit nicht die einzige Reaktion bleibt.
Handeln und Reaktionen anstossen
Verletzte zu retten, ist möglicherweise nicht genug. «Die Mitarbeitenden von Ärzte ohne Grenzen brechen endlich einmal ihr Schweigen in Verbindung mit einem Einsatz. Einer von ihnen wurde im Libanon Zeuge, zu welchen Untaten Menschen fähig sind, und möchte dazu Stellung nehmen» (Tonus, 14. Juni 1976). Es war das erste Mal, dass die noch junge Organisation es für wichtig hielt, über mehr zu informieren, als die Konfliktparteien dies taten. Neben den Berichten der Freiwilligen von Ärzte ohne Grenzen spielten auch die Fotografinnen und Fotografen eine wichtige Rolle. Ohne Fotos könnte man glauben, es hätte nie Opfer gegeben. Die Bilder zeigen betroffene Menschen, überwinden die Distanz zwischen dem Kriegsgebiet und dem Betrachter. Die Fotografie stellt eine Verbindung zwischen Opfer und Betrachter her. Die Person, die das Foto macht, spielt die Rolle der Vermittlerin, die den richtigen Rahmen findet und ihre Version der Realität einfängt.

Aleppo, Syrien, 2012. Eine Familie schaut von ihrem Balkon auf die Stadt. In dieser Phase des Konflikts erschüttern intensive Kämpfe Aleppo.
© Emin Özmen / Magnum Photos«Ich habe den Glauben an viele Dinge verloren, aber ich denke weiterhin, dass es für die Geschichte und das kollektive Gedächtnis wichtig ist, dieKonflikte zu dokumentieren. Wir dürfen nicht vergessen, was passiert ist. 2012, ein Jahr nach Beginn des Konflikts, erreichten die Kämpfe die Grenzen der Türkei. Im Juni wurde das 60 Kilometer von der türkischen Grenze entfernte Aleppo intensiv bombardiert. Diese Tragödie fand ganz in der Nähe meines Landes statt, nur eine Autostunde entfernt. Das berührte und erschütterte mich. Ich dachte an nichts anderes mehr. Als Fotograf konnte ich diesen Krieg, der da ganz in meiner Nähe ausgebrochen war, nicht ignorieren. Tatenlos zusehen war keine Option. Also beschloss ich, über die Grenze zu fahren, um zu bezeugen und zu dokumentieren, was dort passierte.»
Aber diese Realität kann man nur schwer begreifen, und die Berichterstattung zwischen den verschiedenen Einsätzen ist wichtig. Man muss sich Zeit nehmen. Denn in einem solchen Umfeld ist der Zugang zu transparenter und klarer Information unmöglich.

Hama, Syrien, 2011. Regimekritische Demonstranten im Zentrum von Hama bei einem morgendlichen Protest.
© Moises Saman / Magnum Photos««Zu Beginn der Revolutionen des Arabischen Frühlings ging alles zu schnell, und man musste die aktuellen Ereignisse festhalten. Ich hatte keine Zeit, Abstand zu gewinnen, Dinge zu hinterfragen», erläutert der Fotograf Moises Saman 2011 in Syrien. «Mit der Zeit wurde mir jedoch klar, dass auf der visuellen Ebene Fakten alleine nicht ausreichten, um die Komplexität und die Verstrickungen dieses historischen Wandels widerzugeben. In den fünf Jahren, die ich in der Region verbrachte, war ich gezwungen, die einfache Geschichte vom Guten gegen das Böse zu hinterfragen, nachdem ich mit eigenen Augen gesehen hatte, wie schnell die sich Rollen von Opfer und Peiniger drehen können. In diesem von Veränderungen geprägten Kontext habe ich meinen Fokus gefunden und konnte mir Fragen zu meiner Aufgabe und meinen Zweifeln stellen.»»

Aleppo, Syrien, 2012. Kämpfer der Freien Syrischen Armee an der Frontlinie von Al-Arkub.
© Jerome Sessini / Magnum PhotosAuch der Fotograf Jérôme Sessini befand sich 2012 während der Zusammenstösse, die auf den Arabischen Frühling folgten, in Syrien. «Ich hatte meine Meinung zu der Situation in Syrien. Ich hatte einige Vorstellungen und Klischees im Kopf. Was mich dann vor allem geschockt hat, war, wie viele Menschen aus der Zivilbevölkerung getötet wurden. Man hört oft Dinge wie: ‹So und so viele Kämpfer oder Soldaten sind ums Leben gekommen›. Aber in Aleppo stellte ich fest, dass sehr, sehr viele Zivilisten umgebracht wurden.»

Marea, in der Provinz Aleppo, Syrien, 2012. Fatma Al-Krama, umgeben von Familienmitgliedern, neben dem Leichnam ihres 25-jährigen Sohnes Habib Al-Krama. Er wurde von Milizen aus dem Assad-Lager gefoltert und getötet. Sein lebloser Körper wurde auf der Strasse gefunden und in sein Heimatdorf gebracht, um ihn zu beerdigen.
© Moises Saman / Magnum PhotosZusätzlich zu der direkten medizinischen Versorgung der Bevölkerung, insbesondere in den Vertriebenenlagern, begann Ärzte ohne Grenzen 2011 über andere Akteure vor Ort heimlich, zahlreichen Gesundheitseinrichtungen in Syrien beizustehen.
2015 berichtete ein von der Organisation unterstützter Chirurg im ländlichen Norden des Gouvernements Homs von seiner Angst vor den permanenten Luftangriffen, aber auch von seinem Wunsch, vor Ort zu bleiben, um die Operationen fortsetzen zu können. «Ich bin der einzige Allgemeinchirurg für eine Bevölkerung von 100 000 Menschen. Die meisten Chirurgen sind geflohen. Das ist für mich persönlich sehr schwierig. Ich kann all diese Menschen nicht einfach zurücklassen, denn es dürfen keine anderen Chirurgen in die Region hinein. Aber es geht mir hier nicht gut. Meine Frau und die Kinder sind permanent in Gefahr. Auf der einen Seite belastet mich die Situation, auf der anderen Seite weiss ich, dass diese Menschen uns dringend brauchen.»
2013 und 2015 prangerte Ärzte ohne Grenzen den Einsatz von Chemiewaffen an, nachdem viele Patientinnen und Patienten Symptome aufwiesen, die durch den Kontakt mit chemischen Substanzen entstehen. Auch zehn Jahre nach Beginn des Konflikts in Syrien ist Ärzte ohne Grenzen weiter in dem Land und in Geflüchtetenlagern, vor allem im Libanon und in Jordanien, tätig.

Kobanê, Syrien, 2015. Arin mit ihren Zwillingssöhnen. Vor einigen Monaten ist sie nach Kobanê zurückgekehrt.
© Lorenzo Meloni / Magnum PhotosDie Konflikte von heute zeichnen sich durch ihre Komplexität aus. Die humanitären Helferinnen und Helfer sowie Fotojournalistinnen und Fotojournalisten versuchen vor allem, von den Geschehnissen zu berichten – in Worten und Bildern. Es ist ihre Art, die Fakten festzuhalten. Die Fotos und Berichterstattungen gehen weiter als die Aufzählung von Ziffern und Opferstatistiken: Sie dokumentieren die Gewalt, die Zerstörung, den Verlust. So kann keiner mehr sagen, er habe von nichts gewusst, nichts gesehen.
Während des Gefechts um die Rückeroberung Mossuls vom Islamischen Staat 2016 und 2017 waren vier Fotografen von Magnum in der Stadt: Paolo Pellegrin, Jérôme Sessini, Lorenzo Meloni und Moises Saman.
Werde Teil unserer Geschichte, abonniere unseren Newsletter.

Omar Qapchi, Irak, 2016. Ende Oktober stürmten Peschmerga-Kämpfer Omar Qapchi, ein Dorf östlich von Mossul. Nachdem ein gepanzerter Konvoi eine Gruppe von etwa einem Dutzend IS-Kämpfern umzingelt hatte, verfolgten kurdische Soldaten den Feind zu Fuss durch die Strassen.
© Paolo Pellegrin / Magnum Photos
Mossul, Irak, 2016.Verletzte Zivilisten werden nach einem Angriff mit Mörsergranaten und Autobomben von den irakischen Streitkräften behandelt.
© Jérôme Sessini / Magnum Photos
Ausserhalb von Mossul, Irak, 2017. Zivilisten fliehen aus der Stadt.
© Lorenzo Meloni / Magnum Photos
Hammam al-Ali, Irak, 2017. Vertriebene irakische Zivilisten aus West-Mossul suchen Zuflucht in einem informellen Camp ausserhalb von Hammam al-Ali im Süden von Mossul.
© Moises Saman / Magnum PhotosDie Offensive dauerte neun Monate. Jede Strasse, jedes Haus wurde durchsucht, gesichert und die Frontlinie so Stück für Stück verschoben. Die Stadtschlacht, bei der Tausende Irakerinnen und Iraker verletzt wurden oder ihr Leben verloren, gilt als eine der tödlichsten seit dem Zweiten Weltkrieg. Da es noch keinen sicheren Platz innerhalb der Stadt gab, errichtete Ärzte ohne Grenzen im Februar 2017 eine mobile kriegschirurgische Klinik, um die aus der Stadt evakuierten Menschen zu versorgen. Mehrere Monate war diese Struktur jene, die am nächsten an den Kämpfen in West-Mossul gelegen war. Mehr als die Hälfte der Kriegsverletzten aus diesem Stadtviertel wurde in dieser mobilen Einheit behandelt. Im Juni 2017 wurde Ärzte ohne Grenzen auch im Quartier Nablus tätig, einem strategischen Ort, rund drei Kilometer von der Frontlinie entfernt. Die Teams kümmerten sich in der Notaufnahme und dem OP um die direkten Opfer des Konflikts. Im Spital von Nablus waren zu diesem Zeitpunkt die Folgen aller Gräueltaten zu sehen, die die Zivilbevölkerung durch die Kämpfe erlitt. Innerhalb von einigen Wochen nahmen die Teams mehrere hundert chirurgische Eingriffe vor.
Trish Newport, Projektkoordinatorin in Mossul im Jahr 2017, erzählt von einem der Wachmänner von Ärzte ohne Grenzen: «Als ich Mahmoud zum ersten Mal traf, ging er die Strasse von Mossul-West entlang. Weniger als zwei Kilometer entfernt tobte der Krieg. Er trug eine kleine Minzpflanze bei sich. Mein Team und ich waren auf der Suche nach einem grossen Saal für die Stabilisierung von Verletzten. Wir wollten so nah wie möglich an der Frontlinie sein, um die Überlebenschancen beim Krankenwagentransport bis zum Spital zu erhöhen. Aber grosse Räume waren nur schwer zu finden – die meisten grossen Gebäude waren im Krieg zerstört worden. Wir hielten also am Strassenrand neben Mahmoud an und fragten ihn, ob er wisse, wo wir einen grossen Saal finden könnten. Er zeigte uns verschiedene Gebäude und jedes Mal hatte er seine Minze dabei. Als wir ein Gebäude für unsere Klinik gefunden hatten, stellten wir Mahmoud als Wachmann ein. Jeden Tag kam er mit seiner Minze zur Arbeit. In den zweieinhalb Jahren zuvor hatte Mahmoud mit seiner Familie unter der Herrschaft des Islamischen Staats in Mossul gelebt. Während der Besatzung hatte er seinen Kindern beigebracht, Pflanzen zu kultivieren, und seine jüngste Tochter hatte eine Minze herangezogen. Als er seine Kinder in das Vertriebenenlager schickte, bat sie ihn, sich um die Pflanze zu kümmern. Er versprach ihr, sich bis zu ihrer Rückkehr um die Minze zu kümmern. Und das tat er. Diese Pflanze hat uns allen gutgetan. An den Tagen, an denen die Bombardierungen und Kämpfe besonders intensiv waren, schaute ich aus der Klinik auf Mahmoud, der ruhig mit der Pflanze auf den Knien in seinem Wachhäuschen sass. Als mein Einsatz zu Ende ging, brachte Mahmoud mir Minzsamen mit und bat mich, sie bei mir in Kanada anzupflanzen, wo die Pflanzen ein besseres Leben haben könnten.»
In Kriegsgebieten versuchen die humanitären Einsatzkräfte und Fotografinnen und Fotografen, die Realität in all ihrer Komplexität zu erfassen – und machen die gleichen Extremsituationen durch wie die Zivilbevölkerung. Sie möchten diesen Menschen beistehen, immer mit dem Ziel, Augenzeugen zu sein. Sie erleben Verzweiflung und Leid, aber ihr Einsatz bringt auch das Wunder des Überlebens mit sich. Und Erinnerungen, die unauslöschlich sind.
Die jüngsten Foto-Reportagen


Griechenland: An den Toren der Festung Europa - Enri Canaj, 2020

Sudan, Menschen auf der Flucht: An der Grenze – Thomas Dworzak, 2020

Honduras und Mexiko: Hoffnung am Ende des Wegs - Yael Martínez, 2021

Ituri: Inmitten von Rissen ein Schimmery - Newsha Tavakolian, 2021

Mossul, wo die Tauben wieder fliegen - Nanna Heitmann 2021