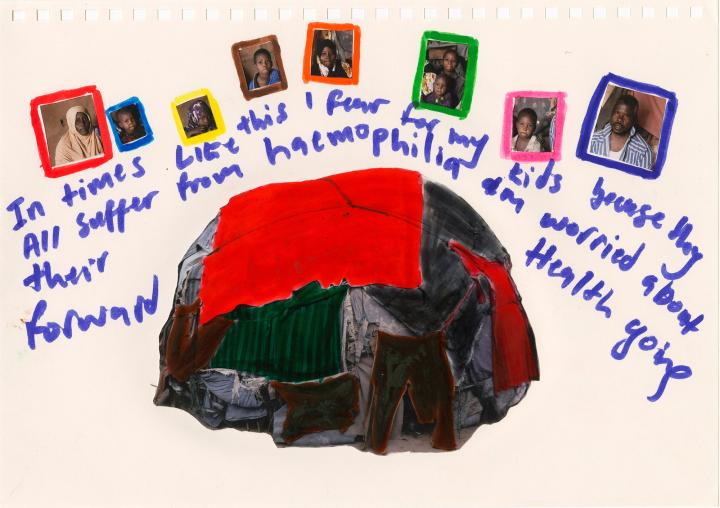Hoffnung am Ende des Wegs
Auf der Flucht vor der Unsicherheit verlassen etliche verzweifelte Familien Honduras. Sie legen Tausende von Kilometern zu Fuss, per Zug oder im Bus zurück, um in die Vereinigten Staaten zu gelangen. Doch sie stranden in extrem gefährlichen Städten in Mexiko, wo sie Opfer von Entführungen, Überfällen und Erpressungen werden. Der mexikanische Fotograf Yael Martínez, der selbst aus dem Bundesstaat Guerrero stammt, verbrachte mehrere Wochen mit Ärzte ohne Grenzen in Mexiko und Honduras. Er traf Menschen, die jedes Risiko eingehen, in der Hoffnung auf ein besseres Leben, auf ein Leben in Sicherheit.
Coatzacoalcos, Mexiko – Immer weiter Richtung Norden

Coatzacoalcos, Region Veracruz, Mexiko. Karen Yoselyn Reyes ist 7 Jahre alt und seit 12 Tagen mit ihrer Mutter und ihrer kleinen Schwester unterwegs. Sie starteten von Yoro in Honduras und liefen von Tapachula (Bundesstaat Chiapas) bis Coatzacoalcos (Bundesstaat Veracruz). Karen hat grosse Angst, dass ihre Mutter es nicht schaffen könnte, auf den Zug Richtung Norden aufzuspringen, weil sie ihre kleine Schwester tragen muss.
© Yael Martínez / Magnum PhotosDer Lärm war ohrenbetäubend. Einen Moment lang spürte ich mein Herz in meinem linken Ohr pochen. Eine Vibration durchlief meinen ganzen Körper – ganz langsam, vom Boden meine Füsse hinauf bis hin zu meinem Kopf. Ich sah, wie jemand ein Geldstück auf die Zuggleise warf und beobachtete wie Yahir, ein achtjähriger Junge aus Honduras, sich bückte, es auflas und es mir mit einem verschmitzten Lächeln reichte. Ich nahm das Stück Metall entgegen, das vor einigen Sekunden noch Kleingeld, eine 50-Cent-Münze, gewesen war. Es war ganz warm vom Reiben des Stahls auf Stahl. Ich dachte über den Zusammenprall dieser zwei Objekte aus Metall nach, den Druck des Lebens, das Unvermeidliche, darüber, was wir suchen, den Druck grosser Dinge auf kleinere. Dieses weggeworfene Geldstück spiegelte unsere Suche wider: Die Gewalt, die wir verkörpern, die Gewalt, die wir erleben, die Lebenswege, die wir eingeschlagen haben.

Coatzacoalcos, Region Veracruz, Mexiko. 23. März 2021. Mehr als 700 Migrantinnen und Migranten aus Zentralamerika verbringen die Nacht unter dieser Brücke in der Nähe der Zuggleise in Coatzacoalcos.
© Yael Martínez / Magnum Photos
Coatzacoalcos, Region Veracruz, Mexiko. 24. März 2021. Die Familie Ramirez wartet unter einer Brücke auf den Zug nach Monterrey.
© Yael Martínez / Magnum PhotosDie Nacht brach herein, und ein weiterer Tag an den Zuggleisen ging zu Ende. Es war dunkel, und die Menschen fanden sich in Gruppen zusammen, um Lagerfeuer zu machen und sich gegenseitig vor der Nacht zu schützen. Die Migrantenunterkunft in Coatzacoalcos war wegen der Pandemie und der Angst vor Covid-19 schon seit Monaten geschlossen. Yahir und sein Vater Wilson sassen beim Versuch, sicher auf einen Zug zu kommen, wochenlang hier fest. Vielen anderen Männern, Frauen und Kindern ging es genauso. Alle warteten darauf, dass der Zug einige Sekunden anhielt, um sicher aufspringen zu können. Die Menschen warteten schon sehr lange, und so langsam verloren sie die Geduld. An diesem Tag war eine Frau beim Versuch, auf den fahrenden Zug zu springen, gefallen. Als sie fiel, war allen vor Schreck das Herz stehengeblieben. Ihre Schreie waren trotz des ohrenbetäubenden Lärms des Zugs zu hören gewesen. Glücklicherweise war sie nicht auf die Gleise gefallen. Sie stand schnell wieder auf und rannte atemlos weiter an den Gleisen entlang, Richtung Horizont. Egal wohin sie auch führten, sie waren ihr Norden.



Coatzacoalcos, Region Veracruz, Mexiko 24. März 2021. Die Familie Zambrano unter der Brücke.
© Yael Martínez / Magnum Photos

Ich verabschiedete mich von Yahir und den anderen Kindern und kehrte mit Yeka ins Hotel zurück. Kurz bevor wir gingen, stellte ich mich nochmal ans Feuer, um die Wärme zu spüren, mich diesen Menschen nahe zu fühlen. Unter der Brücke und an den Zuggleisen vergeht die Zeit anders. Unser Tempo verändert sich an Orten, an denen Träume aufeinanderprallen und Stimmen sich vermischen: die Stimmen von jenen unter uns, die es nicht mehr gibt, und die Stimmen jener, die einst ihre Heimat verliessen.
Werde Teil unserer Geschichte, abonniere unseren Newsletter.


Am nächsten Morgen brachen wir nach Higueras auf, einer Gemeinde nördlich von Coatzacoalcos, einem kleinen Punkt auf der Karte unserer Reise gen Norden. Wir gingen an den Zuggleisen entlang und ich hielt an, um mit zwei Männern zu sprechen, die unter einem Zugwagon schliefen. Ihre Füsse waren zerschunden, sie hatten einen grossen Teil der Reise zu Fuss zurückgelegt. Auf einmal zeigte einer von ihnen in die Richtung eines Wagons etwas weiter weg. Wir sahen eine Familie, die einen Videoanruf vom Dach der «La Bestia», der Bestie, machte. So nennen die Migrantinnen und Migranten den gefährlichen Zug, auf dem sie reisen. Ich näherte mich ihnen und stieg auf das Dach des Wagons. Sie kamen aus Honduras und waren bereits seit zwölf Tagen unterwegs. Karen war das jüngste Familienmitglied. Der Blick der Siebenjährigen war irgendwie anders. Fast so, als wären die Tage für sie eher Jahre gewesen. Eine Art Magie umgab das Mädchen, der Wind liess seine Haare tanzen, es schien den Boden nicht mehr zu berühren und über dem Eisenblock zu schweben. Ich näherte mich, um die Situation festzuhalten. Der Wagon bewegte sich, und mit einem Mal waren wir wieder ganz in der bedrückenden Realität zurück. Es war falscher Alarm, nur ein Zugmanöver. Karen sagte dem Arzt, dass sie sich Sorgen um ihre Mutter und ihre Schwester mache. Dass sie sich um sie kümmern wolle und sehr viel Angst habe. Der Gedanke, dass ihre Mutter es nicht schaffen könnte, auf den Zug aufzuspringen und sie für immer voneinander getrennt sein würden, hielt sie nachts wach.



Coatzacoalcos, Region Veracruz, Mexiko. 25. März 2021. Ein Vater hilft seiner Tochter in Coatzacoalcos auf den Zug zu steigen.
© Yael Martínez / Magnum Photos

Auf dem Rückweg traf ich Edgar und seine Familie. Sie hatten es morgens auf den Zug geschafft, waren aber nur bis Higueras gekommen. Sie ruhten sich in einem kleinen Haus aus, das von einem Feuer zerstört worden war, wie man unschwer erkennen konnte. Vor einigen Tagen waren sie noch fröhlich gewesen. Nun hatte sich der Ausdruck auf ihren Gesichtern verändert. Man konnte die Unsicherheit und die Angst in ihren Augen lesen. Edgar blickte Richtung Horizont; dahin, wo der Zug fuhr. Das letzte Mal als sie versucht hatten, über die Grenze zu kommen, hatten sie sich verlaufen. Sie irrten orientierungslos durch die Wüste. Er gestand mir, dass er geweint hatte wie ein Kind. Er war sich sicher gewesen, dass nun alles zu Ende sei, dass sein Horizont sich für immer verdunkeln würde, dort, mitten in der Wüste. Doch das Grenzkontrollpersonal fand die Familie und rettete sie. Für Edgar war es, als bekäme er ein neues Leben geschenkt. Er dachte, er würde nie mehr einen Versuch wagen. Doch dann machte er sich dennoch erneut auf nach Texas – in eine bessere Zukunft.

Coatzacoalcos, Region Veracruz, Mexiko. 23. März 2021. Landschaft auf dem Weg des Zugs, den die Menschen auf der Flucht «la bestia» (die Bestie) nennen.
© Yael Martínez / Magnum PhotosWas die Reise so schwer macht, ist die Stille, das Schweigen. Inmitten der öden Landschaft wird man nach und nach unsichtbar und verliert Teile seiner selbst, ganz so, als würde man ein Puzzleteil verlieren. Man erkennt das eigene Spiegelbild nicht wieder, verschwindet allmählich in dem Gewirr aus Zeit, Staub und Kälte.
Heute ist unser letzter Tag an den Zuggleisen. Wir sind vor Sonnenaufgang da und sehen sehr viele Menschen, es sind deutlich mehr als bei Sonnenuntergang. Ich treffe auf die Familie Angel und fange ein Gespräch mit dem Vater an. Er erzählt mir, dass er vor Jahren in Monterey in Kalifornien gelebt hat. Dort möchten sie hin. Deverlyn, die Jüngste, ist Mexikanerin. Sie ist hier geboren und hat heute Geburtstag. Yeka verschwindet in einem Laden und kommt mit einem winzigen «Pingüino»-Schokoladenkuchen wieder. Die Streichhölzer dienen als Kerzen und wir singen alle gemeinsam «Las mañanitas», ein traditionelles mexikanisches Geburtstagslied. Die Kleine wird heute zwei Jahre alt, und dem Vater rollt eine Träne über die Wange, als er sie ansieht. Glücklich essen die Kinder den Kuchen und gehen wieder spielen. Etwas abseits fällt Licht auf eine grüne Mauer und Angel spielt mit ihrem Schatten auf der Wand. Bei diesem Anblick denke ich, dass unsere eigenen Schatten unsere Gesellschaft spalten, unsere Ängste und Vorstellungen von dem, was wir waren, was wir sein können und was wir bei den Anderen nicht anerkennen. Die gemeinsamen Stunden verstreichen schnell, und es ist an der Zeit zu gehen. Ich verabschiede mich von allen und sehe Angel von Weitem auf mich zurennen. Er drückt sich fest an mich und sagt mir, dass ich ihm fehlen werde. Ein Schauer überkommt mich. Ich sage ihm, dass er stark bleiben soll und nie aufhören darf, zu träumen. Er soll diese Reise wie ein Spiel sehen, wie ein Traum, der ein Ende hat. Nun ist der Norden für mich der Süden. Sein Land, unser Land. Ich möchte verstehen, warum die Menschen weggehen und warum unsere Kinder nicht mehr von dort kommen werden.
Werde Teil unserer Geschichte, abonniere unseren Newsletter.

Coatzacoalcos, Region Veracruz, Mexiko. 25. März 2021. Angel Alexis Ramirez Mejia, 9 Jahre alt, spielt unter der Brücke von Coatzacoalcos. Vor 16 Tagen brach er mit seiner Familie in Comayagua, Honduras, auf. 14 Tage davon waren sie zu Fuss unterwegs.
© Yael Martínez / Magnum PhotosHonduras – Kein Vergessen
Die Geschichten aus Honduras wurden mir von Familien erzählt, denen ich auf ihrer Reise begegnet bin. Familien aus Lloro, Comayagua, San Pedro, Zambrano, Santa Barbara. Alle sagten das Gleiche: Dass sie nichts mehr zu verlieren haben. Dass sie schon alles verloren haben. Dass sie deswegen weggehen.

Choloma, Region Cortés, Honduras. 8. April 2021. Noch immer sind im Dorf Banderas die Folgen der Hurrikans mit Überschwemmungen von 2020 zu sehen.
© Yael Martínez / Magnum PhotosVon oben betrachtet sieht Honduras aus wie ein paradiesischer, grüner Tropenwald mit vielen Wassernattern. Als ich lande, kommt mir alles bekannt vor, als wäre ich irgendwo in Chiapas oder an der kleinen Küste von Guerrero in Mexiko. Ich kenne das alles, sogar die bedrohliche Stimmung, die sich dort breit macht, wo Gewalt herrscht, ist mir vertraut. Die Wände der Barrios, also der Viertel in Choloma, sind fast identisch mit jenen im Viertel Las Cruces in Acapulco. An beiden Orten sind sie von der Zeit, dem Staub, dem Blut und dem Schweiss der Menschen gezeichnet.

San Pedro Sula, Region Cortés, Honduras. 9. April 2021. Das Quartier Planeta wurde von den Hurrikans im Jahr 2020 zerstört.
© Yael Martínez / Magnum PhotosWenn man durch die Strassen geht, weiss man unbewusst, dass man beobachtet wird, ohne das Gesicht des Beobachters zu sehen oder seinen Namen zu kennen. Diese Namen, sie sind wie vergessene Götter, wie verbrannte Erde.

Choloma, Honduras. Eine Frau, die Opfer sexueller Gewalt wurde, posiert für ein Porträt.
© Yael Martínez / Magnum PhotosY.M. wurde seit ihrem achten Lebensjahr von Familienmitgliedern missbraucht. Es entstand eine grosse Leere in ihr, die sie zwanghaft mit Exzessen zu füllen versuchte, indem sie sich verlor, sich in der Strasse verlor. Ihre Kinder sind der Grund, warum sie weiterleben, kämpfen und sich Schritt für Schritt von diesem Körper verabschieden möchte, der so viele Emotionen ertragen hat. Dieser Körper, gezeichnet von der Familie, der lernt, zu verzeihen und auf der Suche nach neuen Horizonten ist. Das Bild, das sie gewählt hat, um sich darzustellen, ist ein Foto von ihr, auf dem sie in den Feldern arbeitet. Auf dem projizierten Bild sieht man es nicht, aber sie ist schwanger. Und sie fühlt sich glücklich, voller Lebenskraft und Widerstandsfähigkeit, um alles zu bewältigen, was sie auf dieser Welt noch erwartet.
N.V. seufzt traurig, wenn sie an ihre Kindheit zurückdenkt. Wenn sie sich erinnert, wie die Grenze durchbrochen wurde, die ihren persönlichen Raum, ihren Körper und ihre Seele schützte. Dieses Gefühl, wenn man Menschen in die Augen schaut, die Beschützer hätten sein sollen, aber zu Peinigern wurden. Wenn man so etwas erlebt, möchte man nicht mehr leben. Man fühlt sich schuldig und dreckig. Das sagte N.V. uns. Sie hat ein Foto ihrer Tochter ausgewählt, die sich um sie kümmert. Als sie es sich anschaut, entspannen sich ihre Züge. Sie scheint kurz Ruhe zu finden, fängt an zu strahlen – und erfüllt damit den ganzen Raum.

Tegucigalpa, Quartier Nueva Capital, Honduras. 15. April 2021. A.E.A., 34 Jahre alt, Opfer sexueller Gewalt bei sich zu Hause.
© Yael Martínez / Magnum PhotosLorena war sehr nervös und tippte unaufhörlich mit ihrem rechten Fuss auf den Boden. Sie atmete schnell. Als sie begann, ihre Geschichte zu erzählen, erstickten die Tränen, die ihr über das Gesicht liefen, ihre Stimme und sie schwieg. Ihrer Atmung merkte man an, dass sie innerlich zitterte. Cecy reichte ihr eine Serviette, Lorena nahm sie, trocknete sich die Tränen und umwickelte mit der feuchten Serviette den Zeigefinger ihrer linken Hand. In diesem Moment dachte ich an all die Momente der letzten Tage: die intensive Hitze, den Hunger, die zerstörten Landschaften, die zerfallenen Häuser, die Menschen, die darum kämpfen, einen sicheren Ort zu finden. Alle diese Bilder schwirrten mir im Kopf umher und standen im krassen Kontrast zu der ruhigen Atmosphäre der einbrechenden Nacht und dem leisen Vogelgezwitscher.
Guerrero, Mexiko – Kein Ausweg

Dorf El Pescado, Region Guerrero, Mexiko. 28. April 2021. Die Gemeinde von El Pescado ist nicht an die Stromversorgung angeschlossen. Nur die Häuser mit Solarpaneelen haben Elektizität.
© Yael Martínez / Magnum PhotosNach einer zwölfstündigen Reise erreichen wir El Pescado. Bei der langen Anfahrt umgab uns Staub, manchmal konnten wir kaum etwas sehen. Wir hatten das Gefühl, in einer anderen Welt unterwegs zu sein, einer anderen Epoche. Um sich in den Bergen fortzubewegen, muss man die Gegend gut kennen. Das mussten wir schmerzlich erfahren, als wir uns verfuhren. Wir bemerkten es erst, als die Strasse im Nichts verlief. Das kostete uns zwei Stunden. Wir mussten wieder zurückfahren und einen Einwohner bitten, uns die Richtung nach El Pescado, den Weg nach Norden zu zeigen. Als die Nacht sich über die Landschaft legte, waren wir immer noch nicht in dem Dorf angelangt. Wir hatten geplant, um 17 Uhr dort zu sein. Nun war es 20.20 Uhr, und das Tageslicht verschwand. Yeka wurde nervös. Wir alle im Auto wussten, dass es gefährlich ist, nachts auf diesen Strassen unterwegs zu sein. In diesen abgelegenen Gegenden bietet der Staat keinen Schutz, es gelten die Gesetze der lokalen Bevölkerung, die ihre eigenen Sicherheitsdienste schaffen. Alle versuchen, sich vor den Angriffen der Drogenmafia, der verfeindeten Kartelle und Schlägereien zu schützen.
Das ist auch der Grund, warum wir nach El Pescado wollen: Vor einigen Monaten griff eine bewaffnete Gruppe die Einwohnerinnen und Einwohner an und zwang sie, den Ort zu verlassen. Es ist ein Kampf um den Besitz von Land, von Sägereien. Mohn wird hier schon seit langer Zeit nicht mehr angebaut.
Als wir endlich ankamen, bauten wir auf dem Schulhof unsere Zelte auf. In dem Dorf gab es keinen Strom, und in dieser Nacht war der Mond wunderschön. Er erhellte mit seinem Licht die Berge. Wir assen handgemachte Tortillas mit Bohnen, Reis und Hühnchen. Das Essen wurde uns von der Gemeinde vor Ort zur Verfügung gestellt. Nach der langen Anreise schmeckte es köstlich.

Dorf El Pescado, Region Guerrero, Mexiko. 28. April 2021. Maribel Mujica, 18 Jahre alt, mit ihrem 2-jährigen Sohn Gabriel bei sich zu Hause.
© Yael Martínez / Magnum PhotosAm nächsten Tag trafen wir viele Einwohnerinnen und Einwohner. Sie mussten bereits seit Monaten ohne Gesundheitsversorgung auskommen. Die Unsicherheit stand den Menschen ins Gesicht geschrieben, die Angst war allgegenwärtig. In den Strassen patrouillierten das Militär, die mexikanische Nationalgarde und die Staatspolizei, aber man spürte, dass die scheinbare Ruhe im Bundesstaat Guerrero nicht lange anhalten würde.

Dorf El Pescado, Region Guerrero, Mexiko. 28. April 2021. In El Pescado stehen viele Häuser leer. Grund dafür sind die Gewalt und das organisierte Verbrechen im Bundesstaat Guerrero.
© Yael Martínez / Magnum Photos


Dorf El Pescado, Region Guerrero, Mexiko. 29. April 2021. Die Staatspolizei patrouilliert durch das Dorf.
© Yael Martínez / Magnum PhotosWir warteten darauf, mit Javier zu reden. Er erzählte uns von den bewaffneten Männern, die das Dorf stürmten. Von Familien, die alles zurücklassen mussten, von den Schwierigkeiten der Menschen, die zurückblieben. Davon, dass alle sich selbst überlassen sind, dass es keine soziale Betreuung gibt. Er erklärte uns, dass die Einwohnerinnen und Einwohner beschlossen haben, zu bleiben und zu kämpfen. Um ihren Besitz, ihr Land, ihr Volk.
Die Nacht brach herein, und die Menschen gingen nach Hause. Manche von ihnen brauchten dafür selbst auf Eseln oder Pferden mehr als 1,5 Stunden. Die Ärztinnen und Ärzte brachten Lampen für das Gesundheitszentrum mit. Es warteten immer noch Familien, und die Sprechstunden fanden im Halbdunkel statt. Ein Bild hat sich in mein Gedächtnis eingebrannt: Das einer Mutter mit ihren Töchtern, die im Dunkeln nach Hause gingen. Nur das Licht ihrer Mobiltelefone erhellte den Weg, den sie alleine in der Nacht zurücklegen mussten. Ein solcher Nachhauseweg bringt einen an seine Grenzen, man kann nur noch auf das Schicksal vertrauen.

Dorf El Pescado, Region Guerrero, Mexiko. 28. April 2021. Die Familie Arroyo muss zwei Stunden durch die dunkle Nacht laufen, um ihr Haus zu erreichen. Sie mussten wegen des organisierten Verbrechens umziehen.
© Yael Martínez / Magnum PhotosAm nächsten Tag verliessen wir El Pescado. Vorher sprachen wir noch mit einer Familie. Sie waren auf der Flucht, wurden bedroht, die Angst war ihnen deutlich anzusehen. Die Frau willigte ein, mit uns zu sprechen. Wir waren auf dem Weg zum Haus einer Familienangehörigen. Unterwegs trafen wir auf eine andere Frau. Da wurde die Frau, die uns begleitete, auf einmal sehr nervös. Sie erklärte uns, dass alle Einwohnerinnen und Einwohner beobachtet wurden und sie sich nicht sicher fühlte. Sie wollte kein Foto mehr von sich machen lassen, erklärte sich aber bereit, uns von ihren Erlebnissen zu erzählen. Sie sprach in kurzen, abgehackten Sätzen und suchte nach Worten. In den Sprechpausen war ihre Angst zu spüren, und der Ton ihrer Stimme war von den Sorgen geprägt, die sie sich um ihr Leben und das ihrer Familie machte.
Nachmittags fuhren wir zum Dorf El Durazno. Als wir eine Gruppe von Personen mit schweren automatischen Waffen entdeckten, stieg die Anspannung im Auto. Pau stieg aus und redete mit ihnen. Die Männer waren wütend: Sie dachten, dass wir den Menschen in El Pescado, mit denen sie im Konflikt standen, Material geliefert hatten. Es herrschte eine angespannte Stimmung, aber Pau schlug ihnen vor, unser Auto zu inspizieren und so mit eigenen Augen zu sehen, was wir transportierten. Sie verschwanden, und nach ein paar Minuten tauchte ein Vertreter der Dorfbehörden auf. Er entschuldigte sich für die «Begrüssung». Schliesslich gingen wir essen. Am gleichen Nachmittag konnten wir ein Gespräch mit ihm führen. Er erzählte uns von lokalen Gegebenheiten, dem Bedarf, die Wirtschaft auszubauen. Er erklärte uns, warum die Menschen seines Dorfes ihr Land verteidigen und warum es zu Konflikten kommt. Pau fragte, welche Lösung es geben könnte. Einer der bewaffneten Männer ergriff das Wort: Er hoffe, dass der Konflikt käme, je früher, desto besser. Die Nacht brach herein, und der Wind blies durch die Pinien. Nebel umgab die Berge, und schwüle Luft umhüllte uns.
Am nächsten Tag liessen wir das Gebirge hinter uns und fuhren weiter nach Zihuatanejo. Es waren lange Tage, geprägt von einer seltsamen Atmosphäre, einem Gefühl des Schwebens am Rande des Zusammenbruchs. Es fühlte sich an wie ein leichter Schlaf, der einen dem Land näher bringt und einen verletzlich macht. Als höre man Wasser durch die Finger rinnen.

Dorf El Pescado, Region Guerrero, Mexiko. 28. April 2021. Die 7-jährige Amairani Mujica bei sich zu Hause. Wegen des organisierten Verbrechens mangelt es den Familien an Gesundheitsversorgung, Sicherheit und Entwicklungsmöglichkeiten. Viele Menschen wurden zwangsvertrieben.
© Yael Martínez / Magnum PhotosVor einigen Tagen erhielt ich eine Nachricht von Yeka. Es ging um ein Video weinender Frauen, die die Behörden um Hilfe anflehen. Als wir vor Ort waren, hatten diese Frauen medizinische Hilfe in Anspruch genommen. Sie waren noch immer im gleichen Gesundheitszentrum und fürchteten nun um ihr Leben und das ihrer Kinder. Im Hintergrund konnte man Schüsse hören. Man spürte die Angst in diesen Räumen, nahm war, wie die Stimmen brachen. Es waren Stimmen aus anderen Zeiten, Stimmen von Mädchen, Frauen, Müttern, Grossmüttern. Sie vermischten sich zu einer einzigen Stimme, einem einheitlichen Bild mit offenem Herzen. Dieses Land wird einsam, zerstückelt, entwurzelt und unfruchtbar.

Dorf El Pescado, Region Guerrero, Mexiko. 29. April 2021. Ein Grund für die Zwangsvertreibung der Menschen vor Ort ist, dass das organisierte Verbrechen die Kontrolle über die Wälder übernehmen möchte, um Geschäfte mit den Bäumen zu machen.
© Yael Martínez / Magnum PhotosDer Geruch von Staub, von Erde war der gleiche wie in Choloma, in Coatzacoalcos. Es ist der Geruch der Menschen unserer Zeit, unserer Epoche.
Tamaulipas, Mexico – Blut auf dem Asphalt
Die Grenzstädte erschienen mir schon immer brutal. Wie Naturgewalten, die sich gegen uns Menschen aufbäumen, gegen unsere Art, zu denken und das Leben zu begreifen. Menschen gegen Menschen und gegen das, was wir als Realität definieren.


Der Bundesstaat Tamaulipas ist offensichtlich von alledem geprägt. Seine Geografie ist es, sein Land, die Mentalität der Einwohnerinnen und Einwohner. Hier stossen Träume nicht nur an eine Grenze, sie zerplatzen, sie zerbersten. In diesem Gebiet hört man die Stille, betäubend, die Andacht der klagenden Stimmen.


An unserem ersten Tag [in Reynosa] besuchen Sergio und ich eine Unterkunft für Menschen auf der Flucht. Wir sprechen mit einer Familie aus Honduras, die aus Angst, von den eigenen Familienangehörigen getötet zu werden, floh. Die Frau kann ihre Tränen nicht zurückhalten und umarmt ihren Mann. Sie erkennt sich selbst nicht wieder. Sie und ihre Familie sind nicht mehr die gleichen Menschen, die aus Honduras flohen. Die Zeit und die Realität haben sie verändert. Das, was sie erlebt haben, hat sie verändert. Ich bekomme Gänsehaut, als sich die beiden umarmen, sich ansehen und sich wiedererkennen. Sie sind zwar nicht mehr die gleichen wie bei ihrer Abreise aus Honduras, nicht mehr die gleichen wie gestern, aber in dieser schrecklichen Realität haben sie sich zusammen über Wasser gehalten und sind sich so noch näher gekommen.

Reynosa, Region Tamaulipas, Mexiko. 4. Mai 2021. Cindy Caceres, 28 Jahre alt und Carlos Roberto Tunez, 27 Jahre alt. Sie mussten aus Honduras flüchten, da ihr Leben bedroht war . Jetzt beantragen sie politisches Asyl in den USA.
© Yael Martínez / Magnum PhotosEin neuer Tag. Heute haben wir eine multikulturelle Familie getroffen. Der Vater kommt aus Haiti, die Mutter aus Honduras und das jüngste Kind ist mexikanisch. Das Pärchen hat sich in Chiapas kennengelernt und ihr Weg hat sie bis hierhin geführt, in den Norden Mexikos. Als wir in dem Viertel ankamen, fragte mich eine Mexikanerin feindselig, warum ich fotografierte. Ich erklärte ihr unsere Arbeit. Dann gingen wir in das Haus, in der die multikulturelle Familie lebte. Eine Stunde später kam dieselbe Frau erneut auf uns zu. Sie beleidigte und bedrohte uns und befahl uns, das Haus zu verlassen. Mehrere Familien aus Haiti teilten sich das grosse Haus, und das Viertel wurde von Drogenbanden kontrolliert.
Wir gingen. Mir wurde immer mehr der Verfall dieses Staats bewusst. Am nächsten Tag kamen wir noch vor Sonnenaufgang im Camp von Reynosa an, das von Tag zu Tag grösser wird. Derzeit leben rund 500 Menschen dort. Alle warten auf eine Gelegenheit und haben noch ein wenig Hoffnung. Auf den Treppen des Kiosks traf ich Menschen, die am Vortag versucht hatten, über die Grenze zu gelangen. Ihre Anziehsachen waren noch ganz dreckig und nass, ihre Schuhe voller Schlamm. Sie schienen komplett erschöpft, körperlich und psychisch. Ich versuchte, mit ihnen zu sprechen, doch sie wollten nicht, dass ich Fotos von ihnen mache. Ich erinnerte mich, mein Körper erinnerte sich wieder, während meine Muskeln sich anspannten. An Schlafen war in den Tagen darauf nicht zu denken.

Reynosa, Region Tamaulipas, Mexiko. 6. Mai 2021. Rund 400 Menschen aus Honduras, Salvador, Guatemala und Mexiko befinden sich im Zentrum von Reynosa.
© Yael Martínez / Magnum PhotosWir hörten herzzerreissende Berichte. Darin wiederholt sich die Geschichte, der Peiniger scheint immer der gleiche zu sein, derjenige, der den anderen ersticht, nur ein Spiegelbild von uns selbst, von unseren grössten Träumen oder Ängsten.

Reynosa, Region Tamaulipas, Mexiko. 7. Mai 2021. Freddy Alberto Pabon, 49 Jahre alt, verliess Venezuela nach dem Tod seiner Mutter und seines Bruders. Er beantragt politisches Asyl in den USA für sich und seine Familie.
© Yael Martínez / Magnum PhotosWerde Teil unserer Geschichte, abonniere unseren Newsletter.
Diese Welt ist nicht mehr lebenswert, sie wurde gebrandmarkt von unseren Ambitionen und dunklen Wünschen.
Ich verliess Tamaulipas mit Bildern des Todes, der Gefahr. Ich sah, wie eine Frau von einem Mann überfahren wurde. Anstatt ihr zu helfen, wollte er sie loswerden, er trampelte auf ihr herum und schmiss sie auf den Bürgersteig, als wäre sie ein Gegenstand.

Reynosa, Region Tamaulipas, Mexiko. 6. Mai 2021. Luisa Coto, 33 Jahre alt, verliess ihr Land am 19. Februar 2021 nach Morddrohungen. Sie verlor zwei Familienmitglieder. Derzeit lebt sie im provisorischen Camp von Reynosa.
© Yael Martínez / Magnum PhotosIch erinnerte mich daran, was man uns erzählt hatte: dass Frauen und Kinder nachts in den Camps, in denen alle Angst haben, verschwinden, vor aller Augen.
Ich sass im Flieger und konnte nicht aufhören, an diese Frau zu denken: an ihren leeren Blick, abwesend, als wäre sie schon tot. Bei der Erinnerung an die Szene rann mir der Schweiss den Körper hinab wie ihr Blut auf den Asphalt.
Diese Reise stand ganz im Zeichen der menschlichen Resilienz. Eine Aufforderung, für das zu kämpfen, was wir Leben nennen. Mögen alle unsere Stimmen zu einer einzigen werden. Und möge das Lied des Lebens bis in alle Ewigkeit klingen.

Reynosa, Region Tamaulipas, Mexiko. 7. mai 2021. Der Rio Grande in Matamoros.
© Yael Martínez / Magnum PhotosDie jüngsten Foto-Reportagen


Griechenland: An den Toren der Festung Europa - Enri Canaj, 2020

Sudan, Menschen auf der Flucht: An der Grenze – Thomas Dworzak, 2020

Ituri: Inmitten von Rissen ein Schimmery - Newsha Tavakolian, 2021

Mossul, wo die Tauben wieder fliegen - Nanna Heitmann 2021