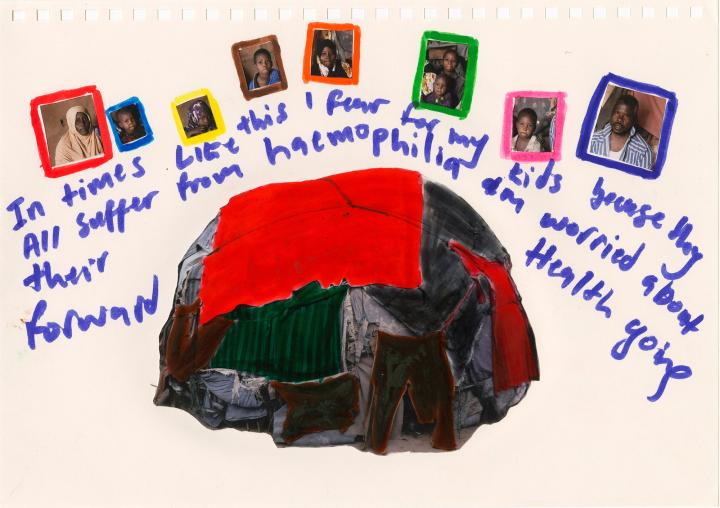Ituri: Inmitten von Rissen ein Schimmer

Manyotsi, 32, mit ihrem sechs Monate alten Sohn. Er ist aus einer Vergewaltigung entstanden. Sie sagt, dass sie ihr Kind trotzdem liebe, es könne schliesslich nichts dafür.
© Newsha Tavakolian / Magnum Photosvon Newsha Tavakolian, DR Kongo, 2021 – unter Mitwirkung von Sara Kazemimanesh
Seit der Eskalation der Gewalt im Jahr 2017 wurden im Nordosten der Demokratischen Republik Kongo über eine Million Menschen Opfer von Vertreibung. Plünderungen, Brandstiftungen und Misshandlungen zwangen unzählige Familien, ihre Häuser zurückzulassen und in Lagern unterzukommen, die schwerlich mehr Schutz bieten. Obendrein haben die Vertriebenen mit Epidemien, sexualisierter Gewalt und zahlreichen Infektionskrankheiten, die den mangelhaften Hygieneverhältnissen geschuldet sind, zu kämpfen. Sie sind auf humanitäre Hilfe angewiesen, entsprechende Organisationen gibt es vor Ort jedoch kaum. Die Fotografin Newsha Tavakolian begab sich nach Ituri, um die Situation vertriebener Frauen und die tägliche Gewalt, der diese ausgesetzt sind, zu dokumentieren.
«Es war eine halbe Stunde vor Frühlings-Tagundnachtgleiche, dem Tag des persischen Neujahrsfest Nouruz. Es heisst, dass das, was man in dem Augenblick macht, in dem sich die Sonne genau über dem Himmelsäquator befindet, darüber entscheidet, wie das nächste Jahr für einen wird. Ich sass in einem Auto auf dem Weg ins Dorf Drodro, um im Auftrag von Ärzte ohne Grenzen ein Projekt zum Thema sexualisierte Gewalt zu verwirklichen.»
In den Autos, die uns entgegenkamen, trugen die Menschen behelfsmässige Kopfbedeckungen zum Schutz vor Staub und Dreck, der von den Fahrzeugen aufgewirbelt wurde. Wir fuhren auf einer matschigen Schotterstrasse, die unter den Reifen nachgab und sich kurvenreich durch die Landschaft wand.
Als wir an einem weiteren Kontrollposten Halt machen mussten, mieden wir die blutunterlaufenen Augen der Soldaten. Die Männer in Uniform gehörten zu nichtstaatlichen bewaffneten Gruppierungen und schienen zum Teil noch viel zu jung. Ich fühlte die Rückseite eines schwieligen Fingers über meine Haut gleiten, während ich mit meinen Augen einen Schimmer fixierte, der durch den horizontalen Riss in der Windschutzscheibe fiel. Das Gegröle der widerlichen Kerle hörte nicht auf. Ich bat den Fahrer, Gas zu geben, um von dort wegzukommen. Ein Stück weiter teilte sich die Strasse. Der eine Weg führte zu einer Lendu-Siedlung, wir aber bogen rechts in Richtung Drodro ab, wo Tausende vertriebene Hema Schutz gesucht hatten. Draussen vor den Hütten ging das Leben weiter. Überall, wo man hinblickte, Menschen, die Maniok ernteten und trockneten.

Vor vielen Jahren wurde in Drodro ein behelfsmässiges Flüchtlingslager errichtet. Es wird Tsuya genannt und beherbergt rund 20 000 Menschen.
© Newsha Tavakolian / Magnum Photos
Drei Jugendliche in einem Feld direkt hinter ihren Hütten in Drodro. Die DR Kongo ist ein sehr rohstoffreiches Land.
© Newsha Tavakolian / Magnum PhotosAls wir im Dorf ankamen, sahen wir eine Gruppe von Menschen, die sich um ein grosses Jesuskreuz versammelt hatten. Ich dachte mir, dass es für den Gottesdienst eigentlich ein paar Tage zu früh war. Wir hatten leider keine Zeit, herauszufinden, was dort vor sich ging, denn wir waren auf dem Weg ins Spital von Drodro, wo ich mangelernährte Mütter und deren Kleinkinder treffen sollte.

Ein Jesuskreuz nahe der Hauptstrasse von Drodro. Menschen kamen dort in dem Glauben zusammen, dass die Jesusfigur aus dem abgebrochenen Fuss blutete. Jeden Tag wuchs die Menge, da die Leute glaubten, Zeuge eines Wunders zu sein und dass ihre Gebete erhört werden würden.
© Newsha Tavakolian / Magnum PhotosUnter den Moskitonetzen waren weinende Kinder zu hören. Ich sah ein sehr ernst dreinblickendes junges Mädchen und fragte sie mithilfe eines Arztes, der für mich übersetzte, ob sie meine Assistentin sein wolle. Sie hielt den Scheinwerfer, während ich filmte. Draussen vor dem Gebäude waren Eltern zusammengekommen und bereiteten aus ihren kargen Essensvorräten, die aus Maniok, Bananen und Ananas bestanden, Mahlzeiten für die Angehörigen im Spital zu.
Werde Teil unserer Geschichte, abonniere unseren Newsletter.

Eine Frau, die ihr Kind im Spital von Drodro entbunden hat. Viele Frauen und Kinder leiden infolge der Nahrungsknappheit an Mangelernährung.
© Newsha Tavakolian / Magnum PhotosObwohl die DR Kongo reich an Rohstoffen wie Erdöl, Diamanten, Kobalt und Gold, ist, lebt der Grossteil der Bevölkerung in extremer Armut. Millionen Menschen wurden vertrieben und erleben tagtäglich körperliche und sexuelle Gewalt, die oft von Milizionären ausgeht. Dass diese ungestraft davonkommen, hat zur Folge, dass Zivilisten – insbesondere Männer – es ihnen gleichtun. Die Opfer sind in erster Linie Frauen und Kinder.


In der Region Ituri, im Nordosten des Kongos, ist der Konflikt zwischen den Lendu-Bauerngemeinschaften und den Hema-Viehzüchtergemeinschaften besonders heftig. Als MSF-Mitarbeitende drei junge Lendu mit Verletzungen zur Behandlung ins Hema-Lager brachten, reagierten einige Hema sofort und umstellten das MSF-Fahrzeug. Sie bedrohten die Hilfskräfte und versuchten sie daran zu hindern, Mitglieder des verfeindeten Stammes in ihrem Lager zu behandeln. Am Ende musste das MSF-Team die drei Verletzten in ein anderes Spital bringen, um eine Eskalation der Situation zu vermeiden.


Im Gespräch mit Mama Justine – Präsidentin der «Synergie des Femmes pour les Victimes des Violences Sexuelles», einer Frauenvereinigung, die Opfern von sexueller Gewalt hilft – erfuhr ich, dass die Normalisierung von sexueller Gewalt nicht allein auf die instabile politische Lage im Kongo zurückzuführen sei, sondern auch auf die Kultur innerhalb der Gesellschaft, die für die Objektifizierung der Frau verantwortlich sei.
So habe es zum Beispiel früher einen Brauch gegeben, bei dem Männer die Frauen, die sie begehrten, regelrecht entführten und in einem Raum einsperrten – das Ganze natürlich ohne deren Einverständnis –, um dann mit der Familie der Frau über eine allfällige Heirat zu sprechen. Mama Justine erzählte mir, dass falsche Vorstellungen und Aberglauben, mit denen sexuelle Gewalt gerechtfertigt wird, die Situation noch zusätzlich verkomplizieren würden. Manche Männer glaubten zum Beispiel, dass der Geschlechtsverkehr mit einer Jungfrau eine HIV-Erkrankung heilen könne.

Drodro 2021.
© Newsha Tavakolian / Magnum Photos
Landschaft in Drodro. Die DR Kongo ist ein sehr rohstoffreiches Land.
© Newsha Tavakolian / Magnum PhotosAndauernde Konflikte

Porträt dreier Kongolesen in Drodro. Viele Männer, die weder Arbeit noch Mittel zum Geldverdienen haben, lassen ihren Frust in Form von Gewalt an Frauen ab.
© Newsha Tavakolian / Magnum PhotosDer Kongo wurde damals wegen seiner natürlichen Ressourcen vom Königreich Belgien kolonisiert. Nachdem das Land zunächst als «Kongo-Freistaat» im Privatbesitz des belgischen Königs Leopold II. gewesen war, wurde es 1908 zur belgischen Kolonie. 1960 führten die Proteste der Bevölkerung gegenüber der Kolonialmacht zur Unabhängigkeit des Kongos. Damit gingen die Konflikte jedoch nicht zu Ende. Die Zustände waren chaotisch und es gab immer wieder Putschversuche und Aufstände.
Mit der Ermordung des ersten rechtmässig gewählten Premierministers des Kongos, Patrice Lumumba, wurde die Möglichkeit zunichte gemacht, eine Zentralregierung zu schaffen, die im Interesse des Volkes gehandelt und vielleicht Jahrzehnte der Konflikte verhindert hätte. Die Diktatur seines Nachfolgers Mobutu Sese Seko dauerte – auch dank der Unterstützung der USA und Frankreichs – 30 Jahre. Dann drangen militante Gruppierungen aus Ruanda unter der Führung von Laurent-Désiré Kabila ins Land und brachten den Diktator im Zuge des Ersten Kongokriegs zu Fall, wodurch die Grundlage für weitere Konflikte geschaffen wurde.


Der Erste Kongokrieg (1996–1997) begann zunächst als Bürgerkrieg und wurde durch die Beteiligung des Sudans, Ugandas und Angolas sowie westlicher Mächte, wie Frankreichs und der USA, dann schnell zu einem internationalen Konflikt. Der Zweite Kongokrieg brach im August 1998 aus und endete offiziell im Jahr 2003, als eine Übergangsregierung die Macht übernahm. Trotz der Unterzeichnung eines Friedensabkommens nahm die Gewalt aber kein Ende, insbesondere im Osten des Landes, wo sich Ituri befindet. Obwohl der Konflikt von Ituri seinen Ursprung in den 1970er-Jahren hat, wird der Name vor allem mit dessen blutigster Phase zwischen 1999 und 2003 in Verbindung gebracht.
Auch heute gibt es noch Spannungen und bewaffnete Auseinandersetzungen.
Gewalt als einzige Option

© Newsha Tavakolian / Magnum Photos
Der Sonnenuntergang war atemberaubend, als ich Giselle traf, ein 16-jähriges Mädchen mit sehr kurzem Haar. Sie trug eine cremefarbene Bluse, einen langen Rock und ein Paar Plastikschlappen mit dem Aufdruck «VIP». Sie erzählte mir, dass ihre Mutter nach der Geburt ihres jüngsten Bruders den Verstand verloren und die Familie im Stich gelassen habe. 2018 griffen eines Nachts Rebellen ihr Dorf an und töteten alle, darunter auch ihren Vater. Giselle und ihre acht jüngeren Geschwister gehörten zu den wenigen Überlebenden. Anschliessend musste sie sich um die Familie kümmern. Zwei Monate vor unserem Treffen war sie mit fünf anderen Frauen Wasser holen. Ihre Kanister waren schwer, sodass sie nur langsam gehen konnte und hinter der Gruppe zurückfiel. Plötzlich erschienen drei bewaffnete Männer, hielten sie fest und zwangen sie, sich auszuziehen. Sie hielten ihr eine Waffe an den Kopf, damit sie nicht schrie. Sie vergewaltigten sie abwechselnd, während die anderen beiden an der Strasse Ausschau hielten.
Mit Blutergüssen übersät und unter Schock stehend raffte sich Giselle schliesslich auf, um zurückzulaufen. Ein vorbeifahrender Motorradfahrer sah, dass mit ihr etwas nicht stimmte, und bot ihr an, sie nach Hause zu fahren. Zurück im Lager bemerkte eine ältere Frau Giselles Zustand. Nachdem sie erfuhr, was passiert war, überzeugte sie Giselle, sich im Gesundheitszentrum behandeln zu lassen. Nach dem Übergriff hatte Giselle einige Zeit Probleme, zu gehen oder länger zu stehen. Sie musste sich jedoch weiterhin um ihre Geschwister kümmern und konnte sich daher nicht ausruhen. Giselle erzählte mir, dass die Vergewaltigung durch die drei Männer ihr erstes Mal gewesen sei und sie seitdem nichts mehr mit Männern zu tun haben wolle. Sie habe sich geschworen, niemals zu heiraten und ihre Ausbildung fortzusetzen, um sich um ihre Geschwister kümmern und den Frauen ihrer Gemeinschaft helfen zu können. Sie strahlte eine grosse Traurigkeit und Einsamkeit aus und erzählte mir, wie verloren sie sich ohne ihre Eltern fühle und dass ihr ihre Mutter jeden Tag fehle.
Ich erkundete das Dorf ein wenig und war beeindruckt von der Schönheit, die mich umgab. Der Himmel wirkte so weit und schien dennoch tief über unseren Köpfen zu hängen, als könnte man mit ausgestrecktem Arm die zuckerwatteartigen Wolken berühren. Ich fand mich erneut vor dem grossen Jesuskreuz und der stetig wachsenden Menschenmenge wieder, die sich darum versammelt hatte. Ich fragte jemanden, wieso all diese Menschen scheinbar zufällig hier zusammengekommen seien. Man antwortete mir, dass aus dem abgebrochenen rechten Fuss Jesu eine purpurrote Flüssigkeit laufe und die Leute glaubten, dass Jesus blute. Ich konnte mich nicht allzu lange am blutenden Jesus aufhalten, da ich auf dem Weg ins Gesundheitszentrum war.
Im Gesundheitszentrum
Im Gesundheitszentrum von Drodro, wo mehr Frauen und Kinder behandelt wurden, als man es für möglich halten würde, traf ich Dr. Jean-Claude. Die Einrichtung war bis vor Kurzem von der «Aktion gegen den Hunger» unterstützt worden. Dann hatten Hema die Zentrale der NGO und deren Fahrzeuge in Brand gesetzt. Das Personal sah sich gezwungen, mit Unterstützung der UN-Mission in der Demokratischen Republik Kongo (MONUSCO) aus dem Land zu fliehen. Mittlerweile arbeitete die Organisation nicht mehr in der Region, was bedeutete, dass die Frauen und Mädchen im Gesundheitszentrum nicht mehr die dringend benötigte kostenlose Versorgung erhielten.


Ich fragte Dr. Jean-Claude, ob wir Englisch sprechen könnten, und er antwortete, dass er es versuchen würde. Ich fragte ihn, ob er wisse, wo ich jemanden finden könne, der mit Opfern von sexueller Gewalt arbeite. Daraufhin sagte er, dass er selbst seit zehn Jahren solche Frauen behandle, und fügte hinzu, dass viele von ihnen die Täter kennen würden und es sich bei ihnen nicht um Milizionäre handeln würde, sondern oft um Mitglieder der eigenen Familie oder um andere Männer ihrer Gemeinschaft.
Im Lager gab es nicht viel zu tun. Die Kinder waren halbnackt. Die älteren unter ihnen halfen ihren Familien mit der Feldarbeit oder beim Wasserholen. Es waren die Frauen, die die meiste Verantwortung trugen. Sie waren für Wasser, Lebensmittel und Feuerholz sowie für die Feldarbeit zuständig. Die meisten sexuellen Übergriffe fanden statt, wenn die Frauen unterwegs waren, um ihre Familie zu versorgen.

Drei Mädchen posieren auf dem Weg, der zum einzigen Ort führt, an dem die Menschen aus dem Rho-Lager oder dessen Umgebung Wasser holen können.
© Newsha Tavakolian / Magnum PhotosDr. Jean-Claude erzählte mir, dass sexuelle Gewalt zum einen eine Kriegswaffe, ja eine Massenvernichtungswaffe sei, dass Männer den Körper der Frau zum anderen aber auch dafür missbrauchen würden, um ihren Frust abzulassen. Ich fragte ihn, warum sie das tun würden. Er erklärte, dass die Männer machtlos und frustriert seien und weder Arbeit noch Mittel zum Geldverdienen hätten und dass die Überbegriffe auf Frauen ihre Art sei, eine gewisse Form von Macht auszuüben. Ich dachte an Nzale, die angegriffen wurde, weil sie nicht die 500 Kongo-Franc (weniger als 1 US-Dollar) hatte, die man von ihr verlangt hatte.
Die Gegensätze waren eklatant: Ein Land mit tropischen Kulturen und beeindruckender Pflanzenwelt, das so ressourcenreich und fruchtbar und zugleich Schauplatz unermesslicher Gewalt ist. Ich verliess das Gesundheitszentrum, nachdem Jean-Claude mir versprochen hatte, mich mit einem humanitären Helfer vor Ort in Verbindung zu bringen, der mit Opfern von sexueller Gewalt arbeite. Auf dem Marktplatz waren sehr viele Frauen unterwegs, die Essen zubereiteten und ihre jüngsten Kinder umhertrugen, während die paar Männer, die vor Ort waren, kaum etwas taten. Der Kongo war wie diese schönen Frauen, die ständig missbraucht wurden und all denen, die es verlangten, ein Stück von sich, von ihrem Körper gaben.


Ich kam an Mädchen in Schuluniformen vorbei – weisse Bluse, dunkelblauer Rock. Sie gingen Seite an Seite mit Jungen, die Schulbücher schleppten. Die Gruppe lief am tiefgrünen Wald entlang. Es war Monsunzeit und an den Bananenblättern glänzten noch die Tropfen des letzten Regens. Ich kam nicht umhin, mich zu fragen, wer gegenüber diesen Mädchen gewalttätig werden könnte. Und wer ihnen helfen würde, wenn überhaupt.
Dr. Serge war Psychologe, der ein neues Programm zur psychologischen Betreuung von Opfern sexueller Gewalt in der Region leitete. Er arbeitete mit den Frauen seit einem Jahr zusammen und sagte mir, dass sie vor allem Scham und Schuld empfänden und auf das Erlebte grundsätzlich auf zwei verschiedene Arten reagierten: entweder mit einem Nervenzusammenbruch oder mit Verleugnen, um das Geschehene zu verdrängen.
Ich musste an die Worte des Priesters denken, den ich zu den Frauen und Mädchen befragt hatte, die bei ihm die Beichte ablegen wollten. Ich hatte ihn gefragt, warum sie dort seien und was sie so unbedingt beichten wollten. Der Priester antwortete mir, dass es Dinge gebe, die sie quälten und die sie niemand anderem ausser Gott anvertrauen könnten. Wie absurd es war, dass sie für Verbrechen um Vergebung baten, deren Opfer sie waren.



Dieudonné, 48 Jahre alt, Priester der römisch-katholischen Kirche von Drodro.
© Newsha Tavakolian / Magnum PhotosDr. Serge sagte, dass die Traumata nicht verschwänden. Sie würden im Laufe der Zeit mehr und mehr Platz einnehmen, die Seele vergiften und immer zerstörerischer werden. Ich fragte ihn, ob die Familien der Opfer die Mädchen unterstützten. Er antwortete, dass einige dies täten und es ihnen dabei helfen würde, die nach einem Übergriff unweigerlich auftretende Scham zu überwinden. Die meisten Familien würden die Opfer jedoch verbannen und ihnen damit keine andere Wahl lassen, als in einem der benachbarten Lager im Exil zu leben oder gar die Familie ihrer Peiniger um Hilfe bitten zu müssen. Wie allein und verängstigt sie sich fühlen mussten, wenn ihr einziger Zufluchtsort ausgerechnet bei den Menschen war, die ihr Leben aus den Fugen gebracht hatten.
Ich blieb in der Nähe des Spitals und wartete darauf, dass man bei mir Fieber mass – eine Vorsichtsmassnahme im Zuge der Pandemie –, damit ich eintreten konnte. Das kaputte Thermometer zeigte bei jedem 32 Grad an, als wäre man gar nicht am Leben. Als ich eintrat, hörte ich spitze Schreie und sah eine Gruppe von rund zehn Frauen, wie sie auf den Treppenstufen mit erhobenen Armen um einen gefallenen Soldaten weinten. Ein anderer Soldat schwang seine Waffe hin und her und erklärte, was passiert war. Mein Dolmetscher meinte gehört zu haben, dass der Soldat sich das Leben genommen habe.


Am Ende des Flurs versammelten sich die Frauen um den leblosen Körper des Soldaten. Er war in weisse Laken gewickelt, seine Augen und sein Mund geschlossen, als würde er nur tief und fest schlafen. Die Frauen warfen sich immer wieder schluchzend auf den Körper. Einige mit dem Mann befreundete Milizionäre kamen dazu und weinten ebenfalls um ihren vermeintlich im Kampf gefallenen Kameraden. Es war mir nicht möglich, herauszufinden, was wirklich passiert war. Welchen Unterschied hätte dies auch gemacht? Die Anwesenden hatten einen geliebten Menschen verloren.
Im Gesundheitszentrum traf ich Honorine, 48 Jahre alt und humanitäre Helferin, die dort seit drei Jahren arbeitete. Honorine zeigte mir ein Heft voller Namen von Mädchen und erzählte, dass jeden Tag mindestens fünf bis sechs Opfer von sexueller Gewalt – die meisten minderjährig und viele zudem schwanger – im Gesundheitszentrum Hilfe suchten. Zahlreiche von ihnen würden von ihrem eigenen Ehemann missbraucht. Honorine erklärte mir, dass sie die Frauen aus den Lagern dazu ermutigten, sich im Falle von Übergriffen im Gesundheitszentrum behandeln zu lassen. Die Einrichtung bot neben Gesundheits-Checks auch Massnahmen zur Prävention und Behandlung von ungewollten Schwangerschaften und von Geschlechtskrankheiten, insbesondere HIV. Als wir den Gang entlanggingen, sah ich einen überfüllten Raum mit rund 15 Schwangeren, die alle darauf warteten, von der einzigen Hebamme vor Ort untersucht zu werden.
Ich fragte Honorine, warum es so viel sexuelle Gewalt gebe. Sie war derselben Ansicht wie Dr. Jean-Claude, dass Vergewaltigung ein Instrument sei, mit dem Männer Macht ausübten und sich für die Erbarmungslosigkeit des Lebens rächen könnten. Für die Milizionäre sei sexuelle Gewalt zudem natürlich ein Mittel, um die lokale Bevölkerung gefügig zu machen und die Ehre anderer Männer mit der Vergewaltigung von deren Frauen zu beflecken. Ich dachte an den Körper der Frau, der als Instrument für diesen Racheakt diente. Viele der Frauen erlebten angesichts der mit einer Vergewaltigung verbundenen Schande zusätzliche Misshandlungen und wurden aus ihren Gemeinschaften verbannt.

Ituri, DR Kongo. Nzale, 30 Jahre alt, auf dem Schoss von Honorine, 48 Jahre alt. Honorine ist Pflegerin, die bei Vergewaltigungsopfern die Erstversorgung und psychologische Unterstützung leistet. Nzale wurde von Rebellen missbraucht, als sie Essen für ihre sieben Kinder holte und ihren Peinigern nicht das Geld geben konnte, das sie verlangten.
© Newsha Tavakolian / Magnum PhotosIch kam erneut am grossen Jesuskreuz vorbei. Dieses Mal fehlten Jesus neben seinem rechten Fuss auch noch beide Arme. Mein Dolmetscher Alphonse erklärte mir, dass der Menge mit der Amputation der Arme bewiesen werden solle, dass es sich bei der Flüssigkeit nicht um Blut, sondern um rostiges Regenwasser vom Metallskelett aus dem Inneren der Statue handle. Ich fragte den Priester, was er vom blutenden Jesus und der Menschenmenge halte, die dieser angezogen hatte. Er antwortete, dass diese Art von Aberglauben gefährlich für die Gemeinschaft sei und er der Spekulation ein Ende setzen wolle. Im sonntäglichen Gottesdienst warne er die Gemeindemitglieder in der vollbesetzten Kirche immer vor den Folgen von Irr- und Aberglauben. Nun schienen die mahnenden Worte die um das Kreuz versammelte Menge wenig zu kümmern. Als ich das nächste Mal an der Stelle vorbeikam, war der blutende, verstümmelte Jesus verschwunden, ebenso wie die Menschentraube.
Zurück im Gesundheitszentrum traf ich Gracian, 52 Jahre alt und Hebamme, die seit 2010 dort arbeitete. In einem düsteren Zimmer mit blauen Wänden sass sie an einem Schreibtisch voller Zettel, Dokumente und Ordner, auf den durch ein kleines Fenster Licht fiel. Während sie eine Schwangere nach der anderen hereinrief, redete ich mit ihr über die vertriebenen Frauen, die sie behandelte. Ich fragte sie, welches das grösste Problem der Frauen sei. Sie antwortete, dass sie vor allem Lebensmittel und Kleidung benötigten. Die meisten von ihnen hatten nur die Kleider, die sie am Leib trugen, und wenn sie schwanger würden, dann würden ihnen diese natürlich nicht mehr passen. Die Frauen waren alles andere als gut genährt und brachten folglich mangelernährte Säuglinge zur Welt.
Die Frauen sassen ruhig da und hörten regungslos zu. Zwei von ihnen stachen mir ins Auge, weil sie viel zu jung schienen, um schwanger zu sein. Es war unmöglich zu sagen, wer durch eine Vergewaltigung schwanger geworden war.
Werde Teil unserer Geschichte, abonniere unseren Newsletter.

Ich legte mich in einem leeren Zimmer schlafen, im Schutz des dünnen Moskitonetzes, das mich umgab. Ich dachte an meinen Vater, der zwei Jahre und elf Tage zuvor gestorben war. Ich hatte in all dieser Zeit nicht einmal zu ihm gesprochen oder ihn in meinen Träumen gesehen. An diesem Abend schien der riesige Mond etwas tiefer am samtartigen Himmel zu stehen als sonst. Im Lager war es ruhig und als ich kurz davor war, einzuschlafen, sah ich plötzlich meinen Vater, der mich sanft schüttelte, um mich aufzuwecken. Ich fragte ihn, was er dort mache und ob er doch noch am Leben sei. Er antwortete mit Nein und wollte mit mir spazieren gehen. Unter dem Vollmond liefen wir auf einem schlammigen Pfad und redeten. Ich stellte ihm Fragen, zum Beispiel ob er glücklich sei, worauf er mit Ja antwortete. Er sagte mir, ich solle ein Tagebuch führen und alle meine Gedanken darin notieren. Ich fragte ihn, warum. Da nahm er ein Büchlein aus einer Tasche, blätterte durch die Seiten und zeigte mir seine Notizen und durchgestrichenen To-do-Listen. Er fragte mich, ob ich mich daran erinnere, und das tat ich. Als ich am nächsten Morgen aufwachte, meinte ich, sein Flüstern in meinem Ohr zu hören, und sah, dass er nicht mehr da war. Ich war so verwirrt, als würde mich ein dichter Nebel umgeben, wie jener am Horizont von Ituri. Ich dachte an das sichere Gefühl, den mir die Erinnerung an meinen Vater selbst nach seinem Tod noch gab, und daran, dass Tausende Frauen im Kongo dieses Gefühl niemals empfinden würden.
© Newsha Tavakolian / Magnum Photos
Spital von Nizi.
© Newsha Tavakolian / Magnum PhotosIm Gesundheitszentrum von Drodro warteten die Frauen darauf, behandelt zu werden. Eine nach der anderen nahmen sie auf dem Stuhl Platz, den ich an die Wand gestellt hatte. Sie fanden kleine Dinge, um sich zu beschäftigen und sich abzulenken, während sie redeten. Das Mädchen mit dem blauen Rock und dem schwarzen Oberteil kratzte sich am Handrücken. In dem düsteren Untersuchungszimmer mit den blauen Wänden stachen die bunten Accessoires, die die zierlichen Körper der Frauen schmückten, besonders hervor: ein blauer Rock, ein rosafarbenes Armband, ein rotes Halstuch, eine Schmetterlingsbrosche, eine Halskette mit blauen Perlen. Sie schauten mich nicht direkt an, aber ich sah sie und erinnere mich an all die kleinen Details, die auch meine Kamera festhielt.
Als ich in Drodro angekommen war, hatte ich befürchtet, dass die Frauen mich meiden würden. Nun war ich erstaunt, dass sie zu mir kamen, um mir ihre Geschichte zu erzählen, und das, obwohl ich nur Fotografin und keine humanitäre Helferin war. Die meisten Opfer hatten mit der Scham und den Schuldgefühlen zu leben, die dieses schlimme Erlebnis, über das sie keine Kontrolle gehabt hatten, über sie gebracht hatten. Man konnte jedoch nicht alle Frauen und Mädchen über einen Kamm scheren. So kollektiv und alltäglich die Erfahrung von Gewalt auch sein mochte, hatte sie doch unterschiedliche Auswirkungen auf jedes Individuum. Und jedes Opfer verdiente es, gehört zu werden.


Noella Alifwa und ihre Kolleginnen von Radio SOFEPADI – das Akronym steht für die Frauenrechtsorganisation «Solidarité Féminine pour la Paix et le Développement intégral» – waren nicht nur hier, um die Geschichten der Frauen zu hören, sondern auch, um die Öffentlichkeit darauf aufmerksam zu machen. Noella und die anderen Frauen arbeiteten seit rund 21 Jahren bei dem lokalen Radiosender. Sie hatten gemeinsam eine NGO gegründet mit dem Ziel, das Thema sexuelle Gewalt zu thematisieren. Noella erzählte mir, dass sie vier wesentliche Ziele verfolgten: erstens die Frauen über ihre Rechte aufzuklären; zweitens friedliche Gemeinschaften zu schaffen, in der sich die Frauen sicher fühlen können; drittens sich für bessere Entscheidungsträger stark zu machen; viertens den Frauen beizubringen, sich um sich selbst zu kümmern, und zwar sowohl unmittelbar nach einem Übergriff als auch auf lange Sicht. Ihre NGO befasse sich mit mehr als 50 Fällen sexueller Gewalt pro Jahr und versuche für die Frauen da zu sein und ihnen zu helfen. Sie glaubten nicht, dass sich alles von einem Tag auf den anderen ändern könne. Im Gegenteil: Sie seien sich bewusst, dass angesichts des kulturellen Hintergrunds, der für die Objektifizierung der Frau verantwortlich sei, und des Fehlens eines verlässlichen Justizsystems eine langsame und stetige Reform der richtige Weg sei. Ich kam nicht umhin, an die aufgebrachte Frau zu denken, die die Botschaften von Ärzte ohne Grenzen über Geschlechtskrankheiten und ungewollte Schwangerschaften infolge von Vergewaltigungen gestört und als blasphemisch und falsch bezeichnet hatte. Ich konnte ihr keinen Vorwurf machen. Feste Überzeugungen lassen sich nicht so schnell überwinden, ganz gleich, wie schädlich sie auch sind. Dafür braucht es Mühe und Zeit.

Die Strasse in Richtung des Rho-Lagers, dem einzigen Ort, an dem die Menschen Wasser holen können.
© Newsha Tavakolian / Magnum PhotosZurück auf der kurvigen Schotterstrasse sah ich Frauen die Strasse entlanggehen. Ihre Körper schwer beladen mit grossen Wasserkanistern und dicken Holzbündeln, die sie zurück ins Lager brachten. Die meisten von ihnen trugen bunte Stofftücher mit besonderen Verzierungen für den 8. März, den Weltfrauentag.
Ich beobachtete ihre Anstrengungen und Ausdauer und fragte ich mich, ob irgendwann der Tag kommen würde, an dem diese Kleider nicht mehr bloss Kleidungsstücke wären und an dem sich die Frauen der wahren Bedeutung des 8. März bewusst würden und sich endlich emanzipieren könnten.
von Newsha Tavakolian, DR Kongo, 2021 – unter Mitwirkung von Sara Kazemimanesh
Die jüngsten Foto-Reportagen


Griechenland: An den Toren der Festung Europa - Enri Canaj, 2020

Sudan, Menschen auf der Flucht: An der Grenze – Thomas Dworzak, 2020

Honduras und Mexiko: Hoffnung am Ende des Wegs - Yael Martínez, 2021

Mossul, wo die Tauben wieder fliegen - Nanna Heitmann 2021