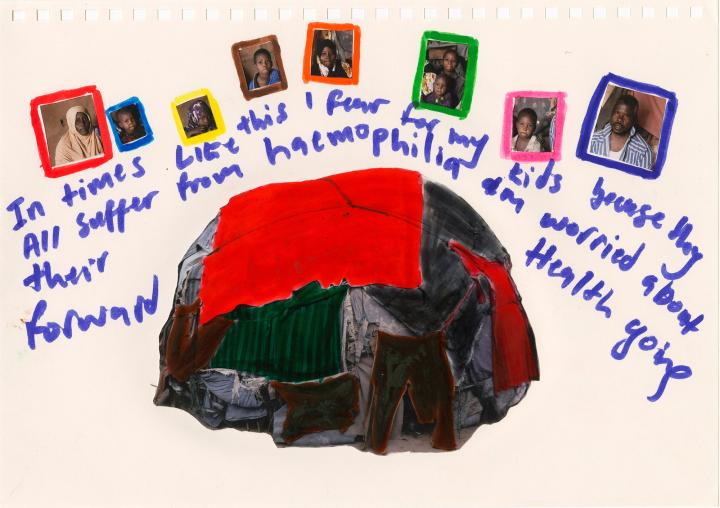Geflüchtete und Vertriebene: Flüchten, um zu überleben

Geflüchtete aus Ruanda im Geflüchtetenlager im Distrikt Ngara in Tansania, in der Nähe der Grenze
Tansania, 1994
Wenn in einer Region Gewalt ausbricht, müssen die Betroffenen oft in Nachbarregionen oder -länder fliehen, um ihr Leben zu retten. Dort ist man nicht darauf vorbereitet, die vielen Flüchtenden aufzunehmen. So entstehen informelle Siedlungen, in denen das Leben neu organisiert werden muss. Humanitäre Einsatzkräfte eilen – wenn sie nicht schon vor Ort sind – zu den Menschen in Not, das gleiche gilt für Fotografinnen und Fotografen. Ihr wichtigste Ziel: Die Würde der Kinder, Frauen und Männer, die keinerlei Einfluss auf ihre schwer zu ertragende Situation haben, trotz der prekären Lebensbedingungen und zahlreichen Beschränkungen zu bewahren oder wiederherzustellen.
Zufluchtsort Geflüchtetenlager
Flüchtende müssen alles hinter sich zurücklassen. Wenn sie dann an einem etwas sichereren Ort angelangt sind, steht erst einmal das Überleben im Vordergrund: Sie benötigen eine Unterkunft sowie Zugang zu Wasser, Lebensmitteln und Sanitäranlagen. Für diese Menschen, die alles verloren haben, sind die Spitäler und die humanitären Helferinnen und Helfer ein Hoffnungsschimmer inmitten des Chaos. Mit der Zeit beginnen sie, ihren Alltag und gegenseitige Hilfe zu organisieren, um eine gewisse Normalität wiederzuerlangen. Diese fangen die Fotografinnen und Fotografen mit ihren Kameras ein.
Werde Teil unserer Geschichte, abonniere unseren Newsletter.

Kambodscha, 1975
© Hiroji Kubota / Magnum PhotosIn den 1970er Jahren flüchteten eine Million Menschen vor der Unterdrückung der Regime in Kambodscha und Vietnam ins Nachbarland Thailand. Für Ärzte ohne Grenzen war es der erste Einsatz in einem Geflüchtetenlager. Die Teams arbeiteten unter der Zulassung anderer NGOs in den Camps von Aranyaprathet und Ban-Vinai und später auch in den Lagern Nam Yao und Chieng-Kong. Im Laufe der Jahre wurden diese behelfsmässigen Zeltsiedlungen zu offiziellen Geflüchtetenlagern. Die Ärztinnen und Ärzte waren in den überfüllten Camps tätig, wo die Menschen ohne Zugang zu Wasser oder Sanitäranlagen zu überleben versuchten.
Claude Malhuret arbeitete 1976 im Camp von Aranyaprathet, in dem zu der Zeit 7000 Geflüchtete lebten. Er erinnert sich: «Damals kannte man noch keine Geflüchtetenlager. Es gab keine medizinische Lehrmeinung zur Behandlung von Geflüchteten, keinerlei Literatur, keine Definition, auf die man sich hätte stützen können. Erst durch die Erzählungen der Männer, Frauen und Kinder vor Ort verstand ich langsam, was für Gräueltaten von den Roten Khmer verübt wurden. Nur sehr zögerlich erzählten die Überlebenden mit ihren ausgemergelten Gesichtern, was sie erlebt hatten. Sie waren von den Schwellungen der durch Vitamin-B1-Mangel ausgelösten Beriberi-Krankheit gezeichnet. Die meisten waren so verängstigt, dass sie bei der geringsten Frage in Tränen ausbrachen.»

Thailand, 1980
© Steve McCurry / Magnum PhotosÄrzte ohne Grenzen erkannte angesichts des fehlenden Materials und Personals in den thailändischen Geflüchtetenlagern, dass eine solide und organisierte Logistikstruktur geschaffen werden muss, um den Bedürfnissen der Geflüchteten gerecht zu werden. Claude Malhuret, der 1978 zum Präsident von Ärzte ohne Grenzen gewählt werden sollte, formulierte es 1977 so: «Die Welt von heute und morgen wird von Flüchtenden geprägt sein. Ärzte ohne Grenzen muss ihren freiwilligen Teams effiziente Mittel an die Hand geben, um diese neue Realität bewältigen zu können.» Dank des Pharmazeuten Jacques Pinel wurde zu dieser Zeit in den Lagern von Sa Kaeo und Khao-I-Dang die Logistikstruktur der Organisation ins Leben gerufen.
Zusammen mit den geflüchteten Menschen versuchten die Mitarbeitenden von Ärzte ohne Grenzen, das Leben in den Lagern neu zu organisieren. Alle halfen mit, als medizinische Hilfskraft oder Pflegepersonal. «Die Gesundheitsbetreuung im Camp war gewährleistet, neue Erkrankte wurden erfasst und die schlimmsten Fälle ins Spital geschickt», so Esméralda Luciolli, die 1979 als Ärztin für Ärzte ohne Grenzen im Geflüchtetenlager von Surin in Thailand tätig war. «Die Hygienebeauftragten organisierten Teams, die Müll einsammelten, brachten den Frauen bei, das Wasser abzukochen und erklärten den Kindern, wie man die Latrinen benutzt.»

Yves Coyette, Arzt bei Ärzte ohne Grenzen, im Geflüchtetenlager von Khao-I-Dang. Thailand, 1984
© Burt Glinn / Magnum PhotosAuch Rony Braumanns erster Einsatz fand in den Geflüchtetenlagern Thailands statt. Im Oktober 1979 traf er in Tap Prik an der Nordgrenze Kambodschas ein, die von 30 000 Flüchtenden überquert wird. Er erinnert sich: «Vor unseren Augen spielte sich die schrecklichste Szene ab, die ich je gesehen habe ... Zehntausende Menschen lagen apathisch am Boden, sie waren am Ende ihrer Kräfte. Ein Meer aus Körpern in Agonie, gestrandet in dieser Ecke der Savanne. Kein Laut war zu hören, noch nicht einmal das Weinen von Kindern, kein einziges Wort wurde gesprochen. Nur Röcheln, Hustenanfälle und das Rauschen des Windes. Und in der Ferne die Laute von wilden Tieren...»
Nur die Überlebenden kamen überhaupt hier an. Ärzte ohne Grenzen konnte die Grenze nach Kambodscha weiterhin nicht überqueren. Ein Teil der Freiwilligen musste den Menschen dort helfen, wo sie am meisten gebraucht wurden und nicht nur ausserhalb des Landes. Anfang 1980 organisierte Ärzte ohne Grenzen deshalb den «Marsch für das Überleben Kambodschas». Zusammen mit internationalen Medien und anderen NGOs forderte die Organisation, das Land für Hilfslieferungen zu öffnen. Vor den Kameras der Welt ergriff Claude Malhuret das Wort: «Im Moment sieht es so aus, dass 500 000 Flüchtlinge aus Kambodscha, 500 000 Zivilisten entlang der Grenze, Gefahr laufen, von einem Tag auf den anderen zurückgedrängt und somit dem Beschuss des Militärs ausgesetzt zu werden. Wir sind hier, um zu fordern, dass das Leben der Zivilisten, der unbewaffneten Menschen verschont wird. Wir bitten euch Soldaten, die ihr uns gegenübersteht, die Lastwagen mit Lebensmitteln und Medikamenten nicht aufzuhalten und die Ärzteteams, die um das einfache Recht bitten, den Überlebenden einer bereits zu lang anhaltenden Tragödie zu helfen, auf kambodschanischen Boden zu lassen. Nur wenige Meter entfernt sitzt unsere Delegation, die Millionen und Abermillionen von Menschen vertritt, die das, was sie jenseits dieser Grenze sehen, aufwühlt. Sie wird den ganzen Tag auf eine Antwort und Genehmigung warten.»
Wie erwartet ging das Regime nicht auf die Forderungen ein. Das war zwar ein Rückschlag, aber durch die umfangreiche mediale Berichterstattung wurde die Öffentlichkeit auf die Situation der Flüchtenden aufmerksam gemacht.
Einige Jahre später, 1994 und 1996, wurde Zentralafrika von Gewalt erschüttert – weitab von den Kameras der Weltmedien. Der Fotograf und Filmemacher Raymond Depardon verbrachte zur Vorbereitung seines Dokumentarfilms Afriques : comment ça va la douleur ? fünf Monate auf dem afrikanischen Kontinent und reiste von Kapstadt in Südafrika bis nach Alexandria in Ägypten. Der Titel seines Films ist eine Anspielung auf die Frage, die ihm die Revolutionäre im Tschad während seines langen Aufenthalts dort oft stellten. Der Schmerz wird hier auf eine unbeschwerte Art und Weise als fester Bestandteil des täglichen Lebens gesehen. Seine Aufnahmen kombinierte Depardon mit kleinen Texten, die er selbst schrieb und las. Dabei handelte es sich nicht um Kommentare, sondern um Einschätzungen, wie er die Situation sah und verstand. Auf seiner langen Reise traf er in Burundi auf die Teams von Ärzte ohne Grenzen. Das Land befand sich mitten in einem Bürgerkrieg. Der Fotograf machte Bilder von den vertriebenen Familien, die ohne Zugang zu lebensnotwendigen Gütern in Zelten hausten. Ärzte ohne Grenzen kümmerte sich in den Camps um Menschen mit Mangelernährung und Krankheiten, die durch die miserablen Lebensbedingungen und der Lebensmittelnot entstanden. Die Organisation unterstützte zudem Spitäler in den verschiedenen Provinzen.


Auch in den tragischsten Situationen liess Raymond Depardon seine Bilder für sich sprechen. «Ich fotografiere nicht, um die Welt zu bereisen. Einige starke Fotos sind so entstanden, aber ich fotografiere wie alle anderen auch. Dabei bin ich manchmal entsetzt, manchmal ändert das, was ich sehe, aber auch meine vorgefassten Meinungen, gute wie schlechte. Man muss aufpassen. Und manchmal muss man loslassen: Die Fotos können uns auch ein wenig in eine andere Richtung lenken.» Hier zeigt sich die Würde, die im Mittelpunkt der Arbeit des Fotografen steht.

Grenzposten in der Nähe von Sahela, zwischen Syrien und dem Irak, 1. November 2019
Gemietete Busse transportieren die kurdischen Flüchtenden vom Nordosten Syriens ins Camp von Bardarash, in der kurdischen Provinz Dohuk im Irak. Irak, 2019
Immer neue Offensiven und Gewaltausbrüche treiben Menschen in die Flucht. So wurde 2019 die kurdische Enklave Rojava entlang der türkischen Grenze im Nordosten Syriens vom türkischen Militär bombardiert. Daraufhin flüchteten mehr als 12 000 Menschen in das irakische Kurdistan.
«Direkt nach Beginn der Kämpfe im Nordosten Syriens haben wir verschiedene Ankunftspunkte der Flüchtenden an der Grenze zwischen dem Irak und Syrien identifiziert, darunter auch Gesundheitszentren und Lager», erklärt Maruis Martinelli, Projektkoordinator von Ärzte ohne Grenzen in Bardarash, dem Camp, wo sich die Flüchtenden niedergelassen haben. Auch der Fotograf Moises Saman befand sich von Anfang an vor Ort.
Besonders was die psychische Gesundheit betrifft, gab es dort dringenden Bedarf. «An unserem ersten Tag vor Ort wiesen die meisten Menschen, die von unserem psychologischen Team untersucht wurden, Symptome von Angst und Depression auf», so Bruno Pradal, Verantwortlicher für mentale Gesundheit bei Ärzte ohne Grenzen.


Gesundheitsmitarbeitende aus der Region zogen in mobilen Teams von Zelt zu Zelt, um die Familien kennenzulernen, Symptome zu identifizieren und eine erste psychologische Unterstützung anzubieten. Jamal und Jalal arbeiten als lokale Gesundheitshelfer und Dolmetscher für Ärzte ohne Grenzen. Sie erlebten am eigenen Leib, wie es ist, Flüchtling zu sein, als ihre Heimat 2014 vom Islamischen Staat erobert wurde. «Wir sind in die Berge geflohen», erzählt Jalal. «Danach haben wir gemeinsam mit einigen meiner Angehörigen die syrische Grenze überquert und in Dohuk, im irakischen Kurdistan, Zuflucht gesucht.» Jamal fügt hinzu: «Als ehemalige Flüchtlinge wissen wir, was diese Menschen durchmachen, da wir Ähnliches erlebt haben. Bei meiner jetzigen Arbeit gehe ich von Zelt zu Zelt, um mit den Familien zu sprechen. Wenn ich Symptome erkenne, die auf ein Trauma hinweisen, kann ich ihnen psychologische Hilfe anbieten.» Moises Saman hat eingefangen, wie die Kinder im Lager zwischen den Zelten vor der Bergkulisse versuchen, Momente der Freiheit zu erhaschen.

Kinder im Lager Bardarash beim Fussball spielen. Irak, 2019
© Moises Saman / Magnum PhotosDie Geflüchteten sind auf der Suche nach einer gewissen Sicherheit in den Lagern, finden sie aber leider nicht immer. Bei der Arbeit mit vertriebenen und geflüchteten Menschen muss man sich an die Restriktionen anpassen, die von den offiziellen und nicht offiziellen Behörden beschlossen werden. Und wenn die Bedingungen nicht mehr akzeptabel sind, muss man sich auch dazu entscheiden, zu gehen.
Die Grenzen der Unterstützung

Lager für Flüchtlinge aus Ruanda im tansanischen Distrikt Ngara, in der Nähe der ruandischen Grenze
Tansania, 1994
Am 6. April 1994 wird das Flugzeug des ruandischen Präsidenten beim Anflug auf Kigali abgeschossen. In den darauffolgenden Tagen kommt es zu ersten Morden an ruandischen Tutsis. Von April bis Juli 1994 werden zwischen 500 000 und einer Million Tutsis Opfer einer systematischen Ausrottung. Dieser Genozid ist der Höhepunkt alter Strategien von extremistischen politisch-militärischen Gruppierungen, die ethnisch begründete Vorurteile gegen die Tutsi-Minderheit schüren. Im gleichen Zeitraum werden von den gleichen Kriminellen auch viele Hutus, die sich gegen die Massaker aussprechen, ermordet. Am 13. April 1994 erreicht ein Notfallteam von Ärzte ohne Grenzen Kigali, die Hauptstadt von Ruanda. Es besteht aus fünf erfahrenen Freiwilligen, darunter Jean-Hervé Brado. Sein Unverständnis bei der Ankunft fasst er so zusammen: «Es gab mehr Tote als Verletzte. Und das, obwohl die verwendeten Waffen keine Massenvernichtungswaffen sind. Die systematische Tötung der Tutsis und nicht kooperierender Hutus überzeugt uns, dass nur ein grosser politischer Wille ein solches Ergebnis zur Folge haben kann.»

In der Nähe der Grenze zu Ruanda, in Goma. Zaire
© Gilles Peress / Magnum PhotosNachdem der Magnum-Fotograf Gilles Peress die Grausamkeiten der ethnischen Säuberung in Bosnien dokumentiert hatte, reiste er während des Genozids nach Ruanda. Er analysiert: «Das enorme Ausmass dieses Verbrechens übersteigt unsere Vorstellungskraft und wird nur noch von der unglaublichen Gleichgültigkeit des Westens und der Industrieländer übertroffen, die einschreiten und diese Tragödie hätten verhindern können.» Mit dem Titel seines 1995 veröffentlichten Buchs The Silence spielt er genau auf dieses Schweigen der internationalen Gemeinschaft an. Das Buch illustriert seine Arbeit in diesem Umfeld. Der Journalist Philip Gourevitch berichtete als Auslandskorrespondent für Paris Review aus Ruanda. Zu den Fotos von Gilles Peress merkt er an: «Was Sie hier auf den Fotografien von Gilles sehen, existiert nur deshalb heute weiter, weil er diese Aufnahmen gemacht hat und Sie sie sich ansehen. Was damals passierte, ist inzwischen nur noch eine Erinnerung. So ist das Leben, und das Leben besteht aus Stimmen. In Ruanda gibt es viele Stimmen, Stimmen voller Erinnerungen.»

Ein Spital in der Nähe des Geflüchtetenlagers Kabgayi. Ruanda, 1994
© Gilles Peress / Magnum PhotosDen internationalen Freiwilligenorganisationen gelang es bei dem Massaker in Ruanda nicht, ihr Personal und ihre Patientinnen und Patienten vor Ort zu schützen, obwohl sie wussten, dass diese sich in Gefahr befanden. Als ihre Mitarbeitenden ins benachbarte Burundi verlegt werden sollten, wurde das Personal aus Ruanda an der Grenze abgewiesen. Zurück in Paris berichtete der für die Projekte von Ärzte ohne Grenzen in Ruanda zuständige Jean-Hervé Bradol von den anhaltenden Gräueltaten im Land. Ärzte ohne Grenzen entschied sich dazu, das Wort zu ergreifen. Die Organisation berief eine Pressekonferenz ein. Am 18. Juni 1994 druckt die französische Zeitung Le Monde den Wortlaut folgendermassen ab: «Wir sind derzeit direkte Zeugen der Ereignisse. Die sorgfältig zusammengestellten Listen mit Menschen, die getötet werden sollen, wurden an meinem ersten Tag verteilt. Getötet wird auf Befehl, Haus für Haus wird ‹gereinigt›. Wer dieses Blutbad anrichtet, ist bekannt: Es handelt sich um die Milizen, die von der Entourage des verstorbenen Diktators angeführt werden. Sowohl der Generalsekretär der UNO als auch der Sicherheitsrat der Vereinten Nationen haben anerkannt, dass wir es mit einem Genozid zu tun haben. Wenn nun auf die Worte keine Taten folgen, ist das unmoralisch. Ein Genozid muss eine radikale, sofortige Reaktion nach sich ziehen. Bis jetzt besteht die einzige Reaktion aus Erster Hilfe. Man stoppt einen Genozid nicht mit Ärzten!» Nach intensiven internen Debatten über die Möglichkeit, mit der humanitären Neutralität zu brechen, entschied sich Ärzte ohne Grenzen schliesslich, zu einer internationalen militärischen Intervention aufzurufen. Frankreichs militärische Mission mit dem Namen «Operation Türkis» rettete schliesslich viele Leben, erleichterte aber auch den Rückzug der ruandischen Streitkräfte ins damalige Zaire.
Hunderttausende Menschen aus Ruanda flüchteten angesichts der offiziellen Propaganda und aus Angst vor Übergriffen durch die Milizen. In Tansania und dem ehemaligen Zaire liessen sie sich in Lagern nieder, wo ihnen humanitäre Einsatzkräfte eine Gesundheitsversorgung anboten.


Während des Sommers 1994 mobilisierte Ärzte ohne Grenzen sich im Kampf gegen Cholera, an der viele Geflüchtete in Zaire litten. Nachdem die Epidemie unter Kontrolle gebracht wurde, waren die freiwilligen Helfenden jedoch schnell mit dem brutalen Einfluss der lokalen Anführer auf die Bevölkerung in den Lagern konfrontiert: Die Camps wurden teilweise zu Rückzugsgebieten für die Rückeroberung Ruandas umfunktioniert. Die Hilfsgüter wurden massiv anderweitig verwendet und die Geflüchteten zu Opfern von Bedrohungen und Übergriffen.
Obwohl alle humanitären Einsatzkräfte empört waren, konnten sie sich nicht auf einen Umgang mit der Situation einigen. Einige waren der Meinung, dass Ärzte ohne Grenzen ihre Arbeit in den Lagern einstellen sollte, andere hatten das Gefühl, dass es noch einen Spielraum gab, um die Lage zu verbessern. Wieder andere sprachen sich dafür aus, dass die Organisation so lange bleiben sollte, wie die Geflüchteten Hilfe benötigten, unabhängig vom Kontext. Im November 1994 forderten die in den Lagern in Kivu, in Zaire, tätigen NGOs den Sicherheitsrat der Vereinten Nationen auf, eine internationale Polizeitruppe zu senden, um die Geflüchteten von den für den Genozid «verantwortlichen Entscheidungsträgern» zu trennen. Der Aufruf lief ins Leere. Die MSF-Bewegung wollte einheitlich auf die Situation reagieren und sah sich folgendem Dilemma gegenüber: Weiter in den Geflüchtetenlagern arbeiten und somit den Einfluss der Anführer des Genozids auf die Bevölkerung stärken oder sich zurückziehen und die hilfsbedürftigen Menschen im Stich lassen. Nach der anfänglichen Soforthilfe entschied sich die Organisation dazu, ihre Aktivitäten einzustellen und verliess die Lager zwischen 1994 und 1995, da sich die Lage nicht verbesserte.

Lager für Geflüchtete aus Ruanda im tansanischen Distrikt Ngara, in der Nähe der ruandischen Grenze.Tansania, 1994
© Gilles Peress / Magnum PhotosZuhören und versuchen, die komplexe Lage zu begreifen

Kontaktbögen der Fotos von Jean Gaumy im Lager Mesa Grande. Honduras, 1985
© Jean Gaumy / Magnum PhotosIn den 1980er Jahren wurden Latein- und Zentralamerika zum Schauplatz intensiver Konflikte, insbesondere in Honduras, Salvador, Guatemala und Nicaragua. Konflikte zwischen Guerillakämpfern und autoritären Regierungen führten zu Bürgerkriegen. Die Bevölkerung, die nicht zwischen den Fronten festsass, floh in die Nachbarländer. Dort liessen sie sich in riesigen informellen Lagern oder direkt in den Gemeinschaften vor Ort nieder. Entlang der 200 Kilometer langen Grenze zwischen El Salvador und Honduras hielten sich mehr als 15 000 Geflüchtete aus El Salvador auf. Im Juli 1980 begann Ärzte ohne Grenzen mit ihrem Einsatz im Lager von Mesa Grande in Honduras, rund 50 Kilometer von der Grenze entfernt. Drei Mediziner und zwei Pflegefachfrauen organisierten zuerst einmal mobile Kliniken für die umliegenden Dörfer. Dort hielten sich Geflüchtete versteckt, die von ihren in El Salvador gemachten Erfahrungen traumatisiert waren. Im Gesundheitszentrum behandelte das Team Erkrankungen, die durch die erbärmlichen Lebensbedingungen entstanden. Aus der Einrichtung wurde ein kleines Spital mit vier Sälen, darunter eine Entbindungsstation.

Geflüchtetenlager Mesa Grande. Mitarbeitende von Ärzte ohne Grenzen. Honduras, 1985
© Jean Gaumy / Magnum Photos
Kontaktbögen der Fotos von Jean Gaumy im Lager Calle Real. El Salvador, 1985
© Jean Gaumy / Magnum Photos1984 reiste Xavier Emmanuelli, der scheidende Präsident von Ärzte ohne Grenzen, in die Projektgebiete in Honduras, El Salvador, Nicaragua und Guatemala. Er nahm zudem einen Journalisten, Claude Mauriac, und einen jungen Fotografen von Magnum, Jean Gaumy, mit. Der humanitäre Helfer wollte dadurch einen von der Organisation unabhängigen Blick auf die Dinge ermöglichen. Auch 40 Jahre später ist er noch davon überzeugt, dass es sehr wichtig ist, mit Bildern zu erzählen, was vor Ort passiert. Denn nur die subjektiven Bilder der Fotografen konnten seiner Meinung nach die menschliche Dimension des humanitären Einsatzes verdeutlichen. Er präzisiert: «Jean Gaumy verstand das! Denn nach seinem Einsatz mit uns ist er auf eigene Kosten erneut vor Ort gewesen, um die begonnene Arbeit zu Ende zu bringen. Jean hat eine ganz eigene Art, mit seinen Bildern Geschichten zu erzählen, die einen gemeingültigen Moment festhalten. Unabhängig vom Geschehen und dem Ort des Geschehens: Auf seinen Fotos macht Jean Menschlichkeit sichtbar. Er empfindet Zuneigung für die Menschen, die er fotografiert. Sein Blick ist betroffen und engagiert.»

Geflüchtetenlager Mesa Grande. Honduras, 1985
© Jean Gaumy / Magnum PhotosEinige Jahre später, 1999, gingen im Kosovo die Übergriffe auf die albanische Bevölkerung weiter. Die Fotografin Cristina Garcia Rodero reiste zu den Vertriebenen und Geflüchteten. Sie erinnert sich: «Als ich erfuhr, dass die Albaner aus dem Kosovo aus ihrem Land ausgewiesen wurden, war ich in Mexiko. Ich machte mich sofort auf den Weg. Ich kannte Skopje und wusste wo die Grenze verlief, also fuhr ich dorthin. Mein nächstes Ziel waren die Geflüchtetenlager. Ich wollte mich mit den Menschen austauschen.»

Kosovo, 1999
© Cristina Garcia Rodero/ Magnum PhotosEinige Jahre später, 1999, gingen im Kosovo die Übergriffe auf die albanische Bevölkerung weiter. Die Fotografin Cristina Garcia Rodero reiste zu den Vertriebenen und Geflüchteten. Sie erinnert sich: «Als ich erfuhr, dass die Albaner aus dem Kosovo aus ihrem Land ausgewiesen wurden, war ich in Mexiko. Ich machte mich sofort auf den Weg. Ich kannte Skopje und wusste wo die Grenze verlief, also fuhr ich dorthin. Mein nächstes Ziel waren die Geflüchtetenlager. Ich wollte mich mit den Menschen austauschen.»

Albanien, 1999
© Cristina Garcia Rodero / Magnum PhotosAuch die humanitären Einsatzkräfte waren im Kosovo. Keith Ursel, der 1998 Nothilfekoordinator von Ärzte ohne Grenzen im Kosovo war, machte auf die Schwierigkeiten vor Ort und die kritische Situation der Vertriebenen aufmerksam. «Die Menschen leiden sehr. Es fehlen Medikamente. Und nun werden auch noch diejenigen zu Zielscheiben, die ihnen helfen. Der Winter steht vor der Tür und im Kosovo wird es gefährlich kalt. Rund 200 000 Menschen wurden vertrieben. Tausende von ihnen leben nun in den Wäldern und erhalten kaum Hilfe.»
Nach den gescheiterten Verhandlungen lancierte die NATO die so genannte «Operation Allied Force», um den Krieg im Kosovo zu beenden. Die Luftangriffe begannen. Ärzte ohne Grenzen evakuierte das Personal aus dem Land, arbeitete aber weiterhin in den Geflüchtetenlagern in Albanien, Montenegro und Mazedonien.
In der Pressemitteilung vom 1. April 1999 kündigte die Organisation an: «Heute Morgen verliess eine DC-8 Ostende in Richtung Tirana und ein weiteres Flugzeug Amsterdam in Richtung Skopje, in Mazedonien. An Bord der beiden Maschinen befinden sich 50 Tonnen medizinisches Material, Decken, Zelte und Plastikplanen, Wasserkanister und Pumpen. Zur Verstärkung unserer Teams vor Ort sind ausserdem vier Freiwillige in der Maschine nach Skopje und drei im Flugzeug nach Tirana.»

Mazedonien, 1999. Geflüchtetenlager in Stenkovac
© Cristina Garcia Rodero / Magnum Photos«Die Kinder spielten. Es zeigt die unglaubliche Fähigkeit der Menschen, sich selbst an die schrecklichsten Situationen anzupassen. Die Kinder rannten mir nach, um mit mir zu spielen. Egal wo ich hinging, folgten sie mir, um mich zum Spielen aufzufordern. Dabei verletzte sich ein kleiner Junge. Auf dem Foto sieht man, wie die anderen Kinder ihn trösten. Sie waren selbst noch klein. Als sie mir aus dem Fenster zugewinkt hatten, hatte sich der Jüngste weh getan und angefangen zu weinen. Die anderen haben sich rührend um ihn gekümmert und ihn beruhigt.» Der Aufenthalt prägte die Fotografin. Sie erläutert am Beispiel dieses Einsatzes den Sinn ihrer Arbeit: «Man muss teilen und Lust haben, zu erzählen, was man sieht. Man muss wissen, welche Geschichte man erzählen möchte, wohin man will und warum genau dorthin, was man damit anfangen möchte, was das Projekt ist, welches Ziel man verfolgt. Und immer auf der Suche sein, ganz geduldig. Und wenn man nicht fündig wird, muss man wiederkommen. Ein weiteres Jahr und noch eins. Und nicht die Motivation verlieren. Dann passieren unvorstellbare Dinge.»


Ab August 2017 flüchteten Tausende Rohingya vor der Gewalt in Myanmar ins benachbarte Bangladesch. «Bevor sie festes Land erreichen, landen die meisten Flüchtlinge auf den schlammigen, flachen Ufern», erklärte Moises Saman, der die Flüchtenden fotografierte, die auch im Herbst weiterhin ankamen. Anschliessend bahnen sie sich mit ihren wenigen persönlichen Habseligkeiten, die sie mitnehmen konnten, einen Weg durch die unwirtliche Landschaft.»
Ein 49 Jahre alter Vater berichtete Ärzte ohne Grenzen: «Ich flüchtete mit meiner ganzen Familie von zu Hause. Auf meinen Sohn wurde geschossen, während er weglief. Eine Kugel traf ihn. Ich habe ihn ins Spital hier in Bangladesch gebracht, musste dafür aber den Rest meiner Familie in einem Wald in Myanmar zurücklassen. Dort verstecken sie sich und sind völlig schutzlos. Ich habe schon seit Tagen nichts von ihnen gehört. Ich weiss nicht, was ich tun soll, ich bin völlig verzweifelt.»
Die meisten Familien liessen sich in improvisierten Lagern in Cox’s Bazar nieder, wo sie ohne Obdach, Nahrung, Trinkwasser und Latrinen leben. Die von Ärzte ohne Grenzen und anderen Organisationen rasch errichteten Gesundheitseinrichtungen waren schnell komplett überlastet. Konstantin Hanke, Arzt von Ärzte ohne Grenzen, war vor Ort. Er berichtet: «515 000 Geflüchtete in fünf Wochen ist für manche eine abstrakte Zahl. Als Mediziner sehe ich hier jedoch genau, was das bedeutet. Die Menschen brauchen unbedingt Hilfe. Wenn wir Pech haben, bricht bald auch noch eine Epidemie aus.»
Werde Teil unserer Geschichte, abonniere unseren Newsletter.

Die 21-jährige Geflüchtete Yasmin mit ihrem fünfjährigen Sohn Mohamed in der Klinik von Ärzte ohne Grenzen in Kutupalong, wo das starke Fieber des kleinen Rohingya-Jungen behandelt wird. Bangladesch, 2017
© Moises Saman / Magnum PhotosInfolge ihres Besuchs im Lager von Cox’s Bazar ergriff die internationale Präsidentin der Organisation, Joanne Liu, bei einer Konferenz des Hochkommissariats für Flüchtlinge der Vereinten Nationen das Wort. «Man kann sich das Ausmass der Krise kaum vorstellen, bevor man es mit eigenen Augen gesehen hat. Die Geflüchteten leben in Camps unter extrem prekären Lebensbedingungen. Ihre behelfsmässigen Unterkünfte aus Schlamm und Plastikplanen sind auf kleinen Anhöhen verteilt und mit Bambus fixiert. Wir dürfen nicht vergessen, dass der Grund für die Vertreibung der Rohingya die aktuelle Krise in Myanmar ist. Die Menschen sind geflohen, weil sie um ihr Leben fürchteten und keine andere Wahl hatten. Hunderttausende von ihnen sitzen nach wie vor in Myanmar fest. Sie leiden weiter unter dieser schrecklichen Situation und sind nun völlig von humanitärer Hilfe abgeschnitten.»
Schätzungen von Studien, die Ärzte ohne Grenzen in den Geflüchtetenlager in Bangladesch durchführte, gehen davon aus, dass vom 25. August bis zum 24. September im Bundesstaat Rakhine in Myanmar mindestens 9000 Rohingya ums Leben kamen. «Wir haben mit Menschen geredet, die der Gewalt in Myanmar gerade noch entfliehen konnten», so Sidney Wong, medizinischer Leiter bei Ärzte ohne Grenzen. Was sie uns erzählt haben, ist schrecklich. Es ist bedrückend, wie viele Menschen berichten, ein Familienmitglied durch Gewalt verloren zu haben. Am schlimmsten ist die grausame Art und Weise, wie sie getötet oder schwer verletzt wurden. Am meisten Todesfälle wurden zu der Zeit verzeichnet, als Sicherheitskräfte aus Myanmar in der letzten Augustwoche mit sogenannten Evakuierungen begannen.» Die Schlussfolgerungen dieser Studie sind eindeutig: Die Rohingya sind Opfer gezielter, anhaltender Übergriffe in Myanmar.
Mehrere Wochen nach seiner Rückkehr erinnert sich Moises Saman an die Ereignisse: «Ich erinnere mich vor allem an die Schwächsten: alte Menschen, unbegleitete Kinder und junge Mütter mit ihren Kindern. Was mich besonders umtreibt, ist, dass die meisten von uns sich absolut nicht vorstellen können, wie es ist, auf der Flucht zu sein. Und dass, obwohl wir direkte Zeugen verschiedener Flüchtlingskrisen in unterschiedlichen Teilen der Welt geworden sind.»

Äthiopische Flüchtende bereiten sich auf die Busreise vom Transitlager Al Hashaba ins Geflüchtetenlager Um Rakuba vor. Sudan, 2020
© Thomas Dworzak / Magnum PhotosDer Flüchtlingsstrom hält auch in der Gegenwart an. Immer neue Gewaltherde auf der ganzen Welt zwingen ganze Bevölkerungsgruppen dazu, ihre Heimat zu verlassen. Aktuellen Zahlen zufolge sind derzeit mehr als 80 000 Millionen Menschen auf der Flucht. Entgegen allgemeinen Annahmen lassen sich 73 Prozent von ihnen in einem Nachbarland nieder. So wie die äthiopischen Geflüchteten im Sudan: Anfang November 2020 brach in Tigray im Norden Äthiopiens Gewalt aus. Bei den Kämpfen stehen regionale Streitkräfte der nationalen Armee von Abbis-Abeba gegenüber. 60 000 Personen flohen über die Grenze ins Nachbarland, während Hunderttausende innerhalb Tigrays vertrieben wurden. Auf der sudanesischen Seite der Grenze steht Ärzte ohne Grenzen bereit, um Neuankömmlinge medizinisch zu versorgen. Im Dezember reiste der Fotograf Thomas Dworzak nach Gedaref. Die Region hatte bereits 1985 im Rahmen der humanitären Krise viele Geflüchtete aus Äthiopien aufgenommen. Innerhalb von 30 Jahren wurden aus den ehemaligen Geflüchtetenlagern Wohngebiete, und die äthiopische Bevölkerung, die dort wohnt, ist gut integriert.
Fotoreportage aus dem Sudan von Thomas Dworzak.

Sonnenuntergang in Al Hashaba, einem der Ankunftsorte für Geflüchtete. Sudan, 2020
© Thomas Dworzak / Magnum PhotosDie jüngsten Foto-Reportagen


Griechenland: An den Toren der Festung Europa - Enri Canaj, 2020

Sudan, Menschen auf der Flucht: An der Grenze – Thomas Dworzak, 2020

Honduras und Mexiko: Hoffnung am Ende des Wegs - Yael Martínez, 2021

Ituri: Inmitten von Rissen ein Schimmery - Newsha Tavakolian, 2021

Mossul, wo die Tauben wieder fliegen - Nanna Heitmann 2021